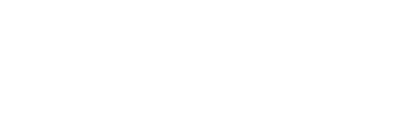OeNB Report 2024/7: Wirtschaftsprognose für Österreich – Sinkende Inflation ermöglicht Konjunkturerholung
Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2024 bis 2026 vom Juni 2024
Friedrich Fritzer, Mathias Moser, Doris Prammer, Christian Ragacs, Lukas Reiss, Richard Sellner, Alfred Stiglbauer und Klaus Vondra 1
Die österreichische Wirtschaft befand sich 2023 in einer Rezession. Gründe hierfür waren die anhaltend hohe Inflation, das sehr schwache außenwirtschaftliche Umfeld und die daraus resultierende allgemein schlechte Stimmungslage. Für das Jahr 2024 erwartet die OeNB eine Stabilisierung der Entwicklung, allerdings wird die Wirtschaft mit 0,3 % nur sehr schwach wachsen. Der private Konsum erholt sich aufgrund deutlich steigender Reallöhne und auch die Exporte tragen positiv zum Wirtschaftswachstum bei. Die Bruttoanlageinvestitionen werden hingegen im Gesamtjahr nochmals schrumpfen. Hohe Finanzierungskosten und schlechte Gewinnerwartungen dämpfen insbesondere die Wohnbau- und die sehr konjunkturreagiblen Ausrüstungsinvestitionen. Für 2025 und 2026 wird einhergehend mit einer Verbesserung des außenwirtschaftlichen Umfelds, vor allem aber aufgrund eines sehr kräftigen Wachstums des realen Konsums, ein Wirtschaftswachstum von 1,8 % bzw. 1,5 % prognostiziert. Der Arbeitsmarkt zeigt sich krisenresistent. Nachdem die Arbeitslosenquote 2024 nur geringfügig auf 6,7 % (AMS-Definition) ansteigt, wird sie bis 2026 wieder auf 6,3 % sinken.
Die österreichische HVPI-Inflation verringert sich im Jahr 2024 auf 3,4 % und damit um mehr als die Hälfte gegenüber 2023 (7,7 %). Für 2025 und 2026 wird mit einem weiteren Rückgang auf 2,7 % bzw. 2,5 % gerechnet. Der Inflationsunterschied zum Euroraum reduziert sich deutlich und liegt in den Jahren 2025 und 2026 mit rund einem halben Prozentpunkt wieder in dem Bereich, in dem er vor dem Inflationsschock war. Die Kerninflation liegt im gesamten Prognosezeitraum über der HVPI-Inflationsrate.
| Hauptergebnisse der OeNB-Prognose vom Juni 2024 | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % (real) | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | –0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,5 |
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) | 7,7 | 3,4 | 2,7 | 2,5 |
| Arbeitslosenquote gemäß AMS (in %) | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Leistungsbilanzsaldo | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Budgetsaldo | –2,7 | –3,1 | –3,3 | –3,0 |
| Öffentlicher Schuldenstand | 77,8 | 77,3 | 77,6 | 78,2 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria; 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
2024 verschlechtert sich der öffentliche Budgetsaldo auf –3,1 % des BIP (2023: –2,7 %) und überschreitet damit leicht die Maastricht-Grenze. Der Hauptgrund hierfür liegt in der verzögerten Auswirkung des Inflationsschocks auf die öffentlichen Finanzen. 2025 verschlechtert sich der Budgetsaldo weiter, 2026 wird er aber wieder auf –3,0 % sinken. Die Schuldenquote geht 2024 auf 77,3 % des BIP zurück, steigt aber in den Folgejahren bis auf 78,2 % (2026) an.
Die Risiken für die Wachstumsprognose sind ausgeglichen. Geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas stellen Abwärtsrisiken dar, eine stärkere Erholung der Inlandsnachfrage ein Aufwärtsrisiko. Aus allen drei genannten Risikofaktoren ergibt sich hingegen ein Aufwärtsrisiko für die Inflationsprognose.
1 Exportwachstum bleibt moderat
Das außenwirtschaftliche Umfeld Österreichs hat sich gegen Ende des Jahres 2022 und im Jahr 2023 deutlich eingetrübt. Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die geldpolitischen Straffungen der weltweit wichtigsten Notenbanken führten zu einer Abschwächung der internationalen Konjunktur. Im Jahr 2022 halbierte sich das Wirtschaftswachstum der Industrieländer, 2023 halbierte es sich beinahe nochmals. Die Entwicklung war aber uneinheitlich: Während sich das Wirtschaftswachstum der USA 2023 sogar leicht beschleunigte, kam der Konjunkturmotor im Euroraum beinahe zum Stillstand. Gebremst wurde dieser wesentlich durch Deutschland, dessen reale Wirtschaftsleistung 2023 stagnierte, bzw. durch Rezessionen in Irland, Österreich und Finnland. Auch in den neuen EU-Mitgliedsstaaten war das Wachstum nur sehr moderat.
Die weltweite Wachstumsschwäche spiegelte sich 2023 auch im sehr schwachen Wachstum der globalen Handelsströme wider. Nach einem Zuwachs von 6,2 % im Jahr 2022 kam das Welthandelswachstum im Jahr 2023 praktisch zum Erliegen (0,4 %). Noch stärker waren die Einschnitte bei den österreichischen Handelspartnern, das Wachstum der österreichischen Exportmärkte sank von +7,3 % im Jahr 2022 auf –1,1 %. Infolgedessen stagnierte das Exportwachstum Österreichs 2023 annähernd (+0,3 %). Trotzdem konnten leichte Marktanteilsgewinne erzielt werden.
Der vorliegenden Prognose liegt die Annahme einer Erholung des Welthandels zugrunde. Die internationale Konjunktur hat sich seit Jahresende deutlich aufgehellt. Das Wachstum der Nachfrage nach österreichischen Exporten wird im laufenden Jahr schwach sein (1,2 %) und in den Jahren 2025 und 2026 mit rund 3,3 % nur knapp unter dem historischen Durchschnitt nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise bis zur COVID-19-Krise (2012–2019: 3,5 %) befinden. Dämpfend wirkt sich der starke Anstieg der Lohnstückkosten und der damit verbundene Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit aus. Die Zuwachsraten der Lohnstückkosten gehen im Prognosehorizont allerdings zurück und das Differenzial zum Euroraum verringert sich.
| Außenhandel und Leistungsbilanz | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Exporte insgesamt | 0,3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 |
| Importe insgesamt | –1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,3 |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Leistungsbilanz | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
|
Quelle: 2023: Statistik Austria;
2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. |
||||
Das Wachstum der realen Exporte wird mit 1,5 % im Jahr 2024 und mit 2,6 % bzw. 2,9 % in den Jahren 2025 bis 2026 nur moderat ausfallen, sich aber dem historischen Durchschnitt nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise von 3,2 % (2012–2019) annähern. Bedingt durch die Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit müssen die österreichischen Exporteure ab dem Jahr 2025 wieder mit leichten Verlusten an Marktanteilen rechnen.
Die Leistungsbilanz erholte sich im Jahr 2023 nach einem Defizit im Jahr 2022 trotz des schwierigen internationalen Umfelds sehr deutlich. Der Saldo drehte von –0,3 % auf selbst im historischen Vergleich hohe +2,7 % des BIP. Hierfür entscheidend war die Entwicklung des Güterhandels, der von der Entspannung bei den Energiepreisen profitierte. Aber auch der Reiseverkehr trug zur Verbesserung des Saldos bei. Für den Prognosezeitraum wird ein stabil hoher Leistungsbilanzüberschuss erwartet.
Kasten 1: Kurzfristprognose für das österreichische Wirtschaftswachstum
Nach der Rezession im Jahr 2023 wächst die österreichische Wirtschaft zu Jahresbeginn sehr verhalten. Dabei zeigt sich ein zweigeteiltes konjunkturelles Bild. Während sich Industrie und Bau nach wie vor in einer Rezession befinden, gehen von den Dienstleistungen bereits wieder positive Wachstumsimpulse aus. Die Stimmungslage der Industrie befindet sich Anfang 2024 weiterhin unterhalb ihres langfristigen Durchschnitts, die Indikatoren zu den Erwartungen kündigen aber eine Entspannung an. Die von geopolitischen Spannungen gedämpfte internationale Konjunktur spiegelt sich in einer schwachen Exportauftragslage wider. Auch hier lassen die Vorlaufindikatoren der letzten Monate auf eine Stabilisierung bzw. leichte Erholung hoffen. Zu Jahresbeginn hat sich die Stimmung im Bausektor weiter verschlechtert, wo die stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten sowie die gesunkene Wohnbauneukreditvergabe die Entwicklung bremsen. Das schwache Wachstum zu Jahresbeginn wurde durch die Erholung im Dienstleistungssektor getragen. Die Vorlaufindikatoren für Dienstleistungen, Einzelhandel und auch die Konsumstimmung verbesserten sich im Frühjahr zunehmend. Angetrieben durch die kräftigen realen Einkommenszuwächse trägt der private Konsum das Wachstum zu Jahresbeginn.
Die Aufhellung der Stimmung und die an Dynamik gewinnende Nachfrage auf den österreichischen Exportmärkten dürften zur Erholung der Industrie im weiteren Jahresverlauf beitragen. Nachfrageseitig sollten sich damit die Exporte und Investitionen schrittweise erholen. Die nachlassenden dämpfenden Effekte der höheren Zinsen und das beschlossene Wohnbaupaket sollten die Baukonjunktur mittelfristig unterstützen. Kurzfristig wird aber von keinen Wachstumsimpulsen seitens der Bauwirtschaft oder einer Erholung bei den Wohnbauinvestitionen ausgegangen.
Die reine Modellprognose des OeNB-Kurzfristprognosemodells 2 ist noch stark von der unterdurchschnittlichen Stimmungslage der Industrie und der schwächeren Arbeitsmarktentwicklung geprägt und signalisiert nur eine verhaltene Entwicklung. Die Erholung der real verfügbaren Nettohaushaltseinkommen dürfte dem privaten Konsum 2024 einen deutlichen Auftrieb verleihen. Um diese nicht im Modell erfassten Entwicklungen abzubilden, wird ein Expert Judgment von jeweils 0,25 Prozentpunkten im zweiten und im dritten Quartal aufgeschlagen. In Summe wird für die Jahresmitte 2024 mit einem Wachstum von 0,3 % im zweiten und 0,4 % im dritten Quartal (jeweils gegenüber dem Vorquartal) gerechnet.
2 Investitionen erholen sich nur langsam
Im Jahr 2023 führten die gestiegenen Finanzierungskosten, die hohen Energiekosten, die gesunkene Nachfrage und die generell hohe Unsicherheit zu einer Verschlechterung der unternehmerischen Erwartungen. Die gesamten Bruttoanlageinvestitionen gingen um 2,2 % zurück. Dabei entwickelten sich die einzelnen Investitionskomponenten sehr heterogen; ein Muster, das auch für den Prognosezeithorizont erwartet wird.
Die im Konjunkturverlauf besonders volatilen Ausrüstungsinvestitionen schrumpfen bereits seit dem Jahr 2022. Sie sind besonders vom investitionsdämpfenden Umfeld betroffen. Nach einem weiteren Rückgang um mehr als 2 % im Jahr 2024 wird in den Jahren 2025 und 2026 einhergehend mit der Belebung des wirtschaftlichen Umfelds wieder ein Anstieg um 2,3 % bzw. 2,6 % erwartet.
Die Wohnbauinvestitionen werden von einer Vielzahl negativer Faktoren beeinträchtigt. Gestiegene Finanzierungskosten und verschärfte Finanzierungsbedingungen gingen mit einem generellen Auslaufen des Wohnbauzyklus und einer sinkenden Nachfrage aufgrund realer Einkommensverluste einher. Die Fertigstellungen waren 2022 mit über 77.000 Wohneinheiten (Neu- und Umbau) auf einem historischen Höhepunkt. Gleichzeitig war bei den Baubewilligungen aber ein deutlicher Einbruch festzustellen (–20 %), der sich im vergangenen Jahr fortsetzte.
| Investitionen | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (real) | –2,2 | –1,9 | 3,0 | 2,7 |
| Ausrüstungsinvestitionen | –2,1 | –2,3 | 2,3 | 2,6 |
| Investitionen in Forschung und Entwicklung | 3,8 | 0,6 | 3,4 | 3,8 |
| Wohnbauinvestitionen | –8,8 | –5,6 | 5,0 | 2,9 |
| Nicht-Wohnbauinvestitionen und andere Investitionen | –2,3 | –1,9 | 2,5 | 1,5 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria; 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
Im Median liegt die Verzögerung zwischen Bewilligung und Fertigstellung bei zwei Jahren, sodass von einem weiteren starken Rückgang bei den Fertigstellungen ausgegangen werden kann. 2023 sanken die Wohnbauinvestitionen um 8,8 %. Dies stellte den stärksten Rückgang seit Einführung der aktuellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung im Jahr 1995 dar. 2024 wird ein weiterer Rückgang um 5,6 % erwartet. Erst 2025 und 2026 wird wieder mit einem positiven, dann aber vergleichsweise starken Wachstum gerechnet. Das Wachstum der Wohnbauinvestitionen wird von dem Wohnbaupaket der Bundesregierung unterstützt, das vor allem Zuschüsse für den geförderten Wohnbau und Sanierungen, erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten sowie günstige Kredite umfasst. Diese erhöhen in Summe das Wirtschaftswachstum im Prognosezeitraum kumuliert um rund 0,2 Prozentpunkte.
Die Nicht-Wohnbau- und Tiefbauinvestitionen sinken seit einem Höhepunkt im Jahr 2019. 2025 und 2026 wird wieder eine leichte Stabilisierung erwartet. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung zeigten sich 2022 (5,2 %) und 2023 (3,8 %) vergleichsweise robust. Sie werden 2024 zwar schwach ausfallen (0,6 %), für die Jahre 2025 und 2026 wird aber wieder ein deutliches Wachstum erwartet.
In Summe erwartet die OeNB für 2024 einen weiteren Rückgang der Gesamtinvestitionen um 1,9 %. Erst 2025 und 2026 kommt es zu einer Erholung, die Investitionen werden um 3,0 % bzw. 2,7 % wachsen. Damit wird das Wachstum wieder im langfristigen Durchschnitt nach der großen Finanz- und Wirtschaftskrise (2012–2019: 2,8 %) liegen. Die Investitionsquote ist seit ihrem Tiefpunkt im Jahr 2010 (21,6 %) bis 2021 laufend angestiegen (25,8 % des BIP), 2023 aber wieder gesunken. Sie wird erst ab dem Jahr 2025 wieder steigen und 2026 23,9 % erreichen.
3 Rückgang des Lohnwachstums und leichte Erhöhung der Arbeitslosigkeit
Das Tariflohnwachstum für 2024 steht schon weitgehend fest, da die allermeisten KV-Abschlüsse im Zeitraum von Jänner bis Mai in Kraft treten. Es wird 2024 8,3 % betragen und damit sogar etwas höher als im Vorjahr (7,6 %) sein. Der OeNB Wage Tracker (Grafik 1) für die Tariflöhne zeigt, dass das unterjährige Wachstum zu Beginn des Jahres am höchsten war, im Verlauf des Jahres aber sinkt (siehe die rote Linie in der Grafik).
In den Folgejahren wird das Lohnwachstum weiter zurückgehen (Tabelle 4). Dies hängt mit dem Rückgang der Inflation zusammen, da die kollektivvertraglichen Lohnsteigerungen in Österreich de facto an die Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate („rollierende Inflation“) indexiert sind.
Die Grafik zeigt auch, dass das Wachstum der Tariflöhne sich im Euroraumvergleich vor allem in Deutschland und in den Niederlanden beschleunigt hat, Österreich aber im laufenden Jahr weiterhin das höchste Wachstum aufweisen wird. Dies hat Implikationen für den privaten Konsum (Abschnitt 4) und die Inflation (Abschnitt 5). Der starke Anstieg der Lohnstückkosten (Tabelle A1 im Tabellenanhang) führt auch zu Verlusten an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Im exportorientierten Sektor der Metallindustrie werden diese negativen Wettbewerbseffekte durch einen Abschluss (+8,5 % KV-Mindestlöhne) unter der rollierenden Inflation (9,5 %) abgemildert.
Zudem wurde in diesem Sektor eine Öffnungsklausel vereinbart, die Unternehmen mit hohem Personalkostenanteil eine Reduktion der effektiven Lohnerhöhung um bis zu drei Prozentpunkte ermöglicht. Außerdem ist festzuhalten, dass das Lohnwachstum 2024 im öffentlichen Dienst deutlich stärker ausfällt als im privaten Sektor. Dies liegt zum einen an dem im sektoralen Vergleich hohen Lohnabschluss im öffentlichen Dienst (+9,3 %) und zum anderen an der konjunkturell bedingten negativen Lohndrift im privaten Sektor. 2024 wird die Differenz bei den Arbeitnehmerentgelten je Beschäftigten zwischen öffentlichem und privatem Sektor 2,3 Prozentpunkte betragen.
Das Wachstum der Beschäftigung in Personen fällt im Jahr 2024 mit 0,4 % konjunkturbedingt schwach aus, erholt sich aber 2025 und 2026 mit 1,0 % bzw. 0,9 % wieder. Das Wachstum der Arbeitsstunden fällt im gesamten Prognosehorizont nur etwas geringer aus als das der beschäftigten Personen (Tabelle 4).
| Arbeitsmarkt- und Lohnentwicklung | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Gesamtbeschäftigung (Personen) | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| Geleistete Arbeitsstunden, insgesamt | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
|
Arbeitnehmerentgelte
je beschäftigter Person |
Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Kollektivvertragslöhne 1 | 7,6 | 8,3 | 4,0 | 2,8 |
| Lohndrift | 0,2 | –0,7 | 0,2 | 0,1 |
| Brutto 2 , nominell | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 2,9 |
| HVPI-Inflationsrate | 7,7 | 3,4 | 2,7 | 2,5 |
| Brutto 2 , real (HVPI) | 0,0 | 4,2 | 1,4 | 0,3 |
| Netto 3 , real (HVPI) | 0,7 | 4,8 | 1,5 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote | in % des Arbeitskräfteangebots | |||
| gemäß Eurostat | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 |
| gemäß AMS | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria; 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024 | ||||
|
1
Gesamtwirtschaft.
2
Inkl.
Dienstgeberbeiträgen.
3 Nach Abzug von Steuern und SV-Beiträgen. |
||||
Damit ergibt sich in diesem Zeitraum auch ein nachhaltiges Wachstum der geleisteten Stunden, was die schwache Arbeitszeitbilanz der letzten Jahre (siehe Kasten 2) verbessert. Die Arbeitslosenquote gemäß AMS steigt 2024 auf 6,7 %, sinkt in den Folgejahren aber wieder leicht. Ähnliches gilt für die Arbeitslosenquote gemäß Eurostat, die im laufenden Jahr bei 5,3 % liegen wird und dann wieder zurückgeht.
Kasten 2: Entwicklung der Arbeitsstunden in Österreich im internationalen Vergleich
Im Folgenden wird die Entwicklung der Arbeitsstunden getrennt nach der Anzahl der beschäftigten Personen und der durchschnittlichen Arbeitszeit für verschiedene Zeiträume für Österreich, den Euroraum und für ausgewählte Länder des Euroraums dargestellt.
Die dritte Spalte der Tabelle K2 zeigt, dass das Wachstum der gesamten Arbeitsstunden im Euroraum sowie in Österreich und auch in den meisten angeführten Mitgliedstaaten in Phasen starker konjunktureller Dynamik hoch war, nämlich in den Jahren bis zur Großen Rezession (2005–2008) und in der Aufschwungphase 2014–2019. In solchen Phasen entwickelten sich sowohl die durchschnittliche Arbeitszeit (vierte Spalte) als auch die Anzahl der beschäftigten Personen (fünfte Spalte) besser als im langjährigen Durchschnitt. In der Phase der Stagnation im Euroraum (2008–2014) war es hingegen umgekehrt. Bei Österreich fällt auf, dass das Wachstum im langjährigen Durchschnitt leicht unter dem Euroraumschnitt lag, die Abnahme der durchschnittlichen Arbeitszeit im Ländervergleich mit –0,8 % pro Jahr aber recht hoch ausfiel.
2019–2023 kam es im Euroraum zu einer deutlichen Zunahme der Arbeitsstunden von 0,8 % pro Jahr, die nur geringfügig unter dem Wachstum der beschäftigten Personen lag (1,0 %). In vielen Euroraumländern ist die Stundenbeschäftigung trotz der innerhalb dieser Periode gelegenen Krisen (COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieg) deutlich angestiegen, vor allem in Frankreich, Italien und den Niederlanden. In Österreich und Deutschland haben die Arbeitsstunden 2023 hingegen noch nicht ganz das Niveau von 2019 erreicht. In beiden Ländern kam es zu einem Sinken der durchschnittlichen Arbeitszeit, das im Fall von Österreich mit –1,3 % besonders stark ausfiel.
|
Durchschnittliches jährliches Wachstum
der Arbeitsstunden |
||||
| Land | Periode |
Stunden
gesamt |
Davon:
Durchschnittliche Arbeitszeit |
Davon:
Beschäftigte Personen |
| EA | 2005–2008 | 1,6 | 0,0 | 1,7 |
| 2008–2014 | –1,0 | –0,5 | –0,5 | |
| 2014–2019 | 1,3 | –0,2 | 1,5 | |
| 2019–2023 | 0,8 | –0,3 | 1,0 | |
| 2005–2023 | 0,5 | –0,3 | 0,8 | |
| AT | 2005–2008 | 1,2 | –0,8 | 2,0 |
| 2008–2014 | –0,3 | –1,0 | 0,8 | |
| 2014–2019 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| 2019–2023 | –0,1 | –1,3 | 1,1 | |
| 2005–2023 | 0,4 | –0,8 | 1,2 | |
| DE | 2005–2008 | 1,8 | 0,4 | 1,4 |
| 2008–2014 | 0,3 | –0,5 | 0,8 | |
| 2014–2019 | 0,9 | –0,4 | 1,3 | |
| 2019–2023 | –0,2 | –0,6 | 0,4 | |
| 2005–2023 | 0,5 | –0,4 | 0,9 | |
| ES | 2005–2008 | 2,4 | –0,3 | 2,7 |
| 2008–2014 | –3,1 | –0,2 | –2,9 | |
| 2014–2019 | 2,6 | –0,2 | 2,7 | |
| 2019–2023 | 0,6 | –0,6 | 1,1 | |
| 2005–2023 | 0,4 | –0,3 | 0,7 | |
| FR | 2005–2008 | 1,4 | 0,3 | 1,1 |
| 2008–2014 | –0,2 | –0,3 | 0,1 | |
| 2014–2019 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | |
| 2019–2023 | 1,7 | –0,2 | 1,8 | |
| 2005–2023 | 0,8 | –0,1 | 0,9 | |
| IT | 2005–2008 | 1,1 | –0,2 | 1,3 |
| 2008–2014 | –1,6 | –0,9 | –0,7 | |
| 2014–2019 | 0,9 | –0,2 | 1,0 | |
| 2019–2023 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | |
| 2005–2023 | 0,3 | –0,1 | 0,4 | |
| NL | 2005–2008 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| 2008–2014 | –0,4 | 0,0 | –0,4 | |
| 2014–2019 | 2,4 | 0,3 | 2,2 | |
| 2019–2023 | 1,2 | –0,7 | 2,0 | |
| 2005–2023 | 1,2 | –0,1 | 1,3 | |
| Quelle: Eurostat, OeNB. | ||||
|
Anmerkung: Die angeführten Daten beziehen sich auf
die
Gesamtbeschäftigung (Arbeitnehmer:innen und Selbstständige). Rundungsdifferenzen sind möglich. |
||||
Was steckt hinter dieser Entwicklung? Im Gegensatz zu den bisher dargestellten Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erlauben die Daten aus der Europäischen Arbeitskräfteerhebung eine Darstellung des Wachstums der beschäftigten Personen nach Geschlecht und nach Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigung. Die nachfolgende Grafik K2 zeigt, dass es in den Phasen mit hohem Beschäftigungswachstum (2005–2008 und 2014–2019) fast durchwegs zu einer Zunahme der Vollzeit- und der Teilzeitbeschäftigung bei Frauen und Männern gekommen ist. Von 2008 bis 2014 hat hingegen in fast jedem Mitgliedstaat die Vollzeitbeschäftigung abgenommen.
In der jüngsten Periode seit 2019 ist die Entwicklung hingegen relativ heterogen. Während im Euroraum die Beschäftigung in allen Kategorien zugenommen hat und die Niederlande, Spanien und Frankreich ein starkes Beschäftigungswachstum mit einer Zunahme der Vollzeitbeschäftigung verzeichnen, ist in Österreich und Deutschland lediglich die Teilzeitbeschäftigung gestiegen, und zwar bei Frauen und bei Männern, während die Vollzeitbeschäftigung sogar leicht gesunken ist. Zumindest bisher zeigt sich hier in den beiden Ländern ein ähnliches Bild wie in der Stagnationsphase 2008–2014.
Die Zunahme der Teilzeitbeschäftigung ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei jüngeren (bis 39 Jahre) und bei älteren (ab 40 Jahren) Arbeitskräften zu beobachten. Eine Betrachtung nach dem Bildungsgrad zeigt, dass der Anstieg der Teilzeitbeschäftigung vor allem bei Frauen mit tertiärem Bildungsabschluss stattgefunden hat, während er bei Männern gleichmäßiger auf alle Bildungsstufen verteilt ist.
4 Privater Konsum als wichtigster Treiber des Wirtschaftswachstums
2023 schrumpften die real verfügbaren Einkommen der Haushalte infolge des Inflationsschocks geringfügig (–0,2 %). Das Wachstum der realen Arbeitnehmerentgelte trug nur wenig zum Haushaltseinkommen bei. Dem österreichischen Lohnfindungsprozess folgend gehen die hohen Inflationsraten mit einem Jahr Verzögerung in die Kollektivvertragslohnsteigerungen. Dieser zeitversetzte Inflationsausgleich führt dazu, dass es erst in einer Phase fallender Inflation zu einem Ausgleich zuvor erlittener Reallohnverluste kommt. Diesem Muster folgend steigen 2024 und 2025 die realen Nettoarbeitnehmerentgelte deutlich an. Deren Wachstumsbeitrag zum real verfügbaren Haushaltseinkommen beträgt 2024 2,4 Prozentpunkte und ist somit so groß wie nie zuvor seit der Einführung des Euro im Jahr 1999. Auch 2025 tragen die Arbeitnehmerentgelte (Löhne pro Kopf und Beschäftigung) mit 1,5 Prozentpunkten überdurchschnittlich zum Wachstum des Haushaltseinkommens bei. Zusätzlich erhöhen die Sozialtransfers in den Jahren 2024 und 2025 das reale Haushaltseinkommen (Wachstumsbeitrag von 1,4 bzw. 1,0 Prozentpunkten). Auch hier zeigt sich die verzögerte Inflationsabgeltung, wie z. B. bei den Pensionszahlungen und Familienleistungen. Im Gegensatz hierzu verringert im Jahr 2024 die Entwicklung der Vermögens- und Selbstständigeneinkommen das real verfügbare Haushaltseinkommen, wobei der Rückgang vor allem auf Ausschüttungen, Entnahmen und Pachteinkommen von Unternehmen zurückzuführen ist. 2025 und 2026 erwarten wir keine nennenswerten Beiträge der Vermögens- und Selbstständigeneinkommen zum realen Haushaltseinkommen.
Der starke Anstieg der verfügbaren Haushaltseinkommen ermöglicht eine stärkere private Konsumnachfrage. Diese wird zur Hauptstütze des konjunkturellen Aufschwungs. Mit einem Zuwachs von 1,5 % im Jahr 2024 und von 2,2 % bzw. 1,6 % in den Jahren 2025 und 2026 liegt das Konsumwachstum deutlich über dem langfristigen Durchschnitt vor der COVID-19-Pandemie (2012–2019: 0,8 %). Trotz des sehr starken Konsumwachstums wird im Jahr 2024 aufgrund von Vorsichtsmotiven und Vertrauenseffekten ein Anstieg der Sparquote auf 10,3 % erwartet (2023: 9,0 %). Die Sparquote stabilisiert sich 2025 und geht 2026 geringfügig auf 10,1 % zurück.
| Reale Haushaltseinkommen und privater Konsum | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Verfügbares Haushaltseinkommen, real | –0,2 | 3,0 | 2,4 | 1,1 |
| Privater Konsum, real | –0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,6 |
|
in % des verfügbaren
Haushaltseinkommens |
||||
| Sparquote | 9,0 | 10,3 | 10,5 | 10,1 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria; 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
5 Inflation wird sich 2024 gegenüber 2023 mehr als halbieren
Die OeNB erwartet in ihrer aktuellen Inflationsprognose, dass sich die HVPI-Inflationsrate von 7,7 % im Jahr 2023 auf 3,4 % im Jahr 2024 mehr als halbiert. In den Jahren 2025 und 2026 wird sich der Rückgang der Inflationsrate verlangsamen: Diese fällt zunächst auf 2,7 % und dann auf 2,5 %. Die Kerninflationsrate (HVPI-Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel) sinkt teilweise getrieben durch Basiseffekte auf 4,2 % im Jahr 2024, liegt damit aber über der HVPI-Inflationsrate. Auch 2025 und 2026 bleibt die Kerninflation mit 2,9 % sowie 2,6 % über der Gesamtinflation. Über den gesamten Prognosezeitraum bleiben damit sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflationsrate deutlich über ihren langfristigen Durchschnittswerten (von 2011 bis 2019: 1,9 % bzw. 2,0 %).
Der Rückgang der Inflationsrate im Jahr 2024 geht auf alle Hauptkomponenten des HVPI zurück, vor allem aber auf Industriegüter ohne Energie sowie Energie und Nahrungsmittel. Dafür ausschlaggebend sind die schwache Nachfrage wie auch rückläufige Produzentenpreise. Zudem wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit weiteren Preissenkungen bei den Haushaltsenergiepreisen gerechnet. Im Fall von Dienstleistungen wirkt die dynamische Lohnkostenentwicklung einem stärkeren Rückgang der Inflationsrate entgegen.
Fiskalische Maßnahmen beeinflussen vor allem die Energie- und Dienstleistungsinflation. Anfang 2025 wird das Auslaufen fiskalpolitischer Maßnahmen (Strompreisbremse, Wiedereinführung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe, Wiedereinführung der Erneuerbarenpauschale) sowie die Erhöhung des CO2-Preises die HVPI-Inflationsrate – isoliert betrachtet – um rund 0,6 Prozentpunkte anheben. 3 Die im August 2023 von der Regierung beschlossene Deckelung der Mietpreisanstiege und die Aussetzung der Gebührenanpassung werden die Dienstleistungsinflation 2024 und in den Folgejahren leicht verringern.
Im Vergleich zum März 2024 wurde die OeNB-Prognose für die Gesamtinflationsrate für 2024 um 0,2 Prozentpunkte nach unten revidiert, für 2025 unverändert belassen (Tabelle 6) und für 2026 um 0,2 Prozentpunkte angehoben. Bei den Hauptkomponenten des HVPI kam es vor allem im Jahr 2024 zu größeren Verschiebungen. Die HVPI-Inflationsprognose für Dienstleistungen wurde 2024 aufgrund des erwarteten höheren Lohnwachstums nach oben revidiert, während bei Industriegütern ohne Energie, Nahrungsmitteln und Energie eine Abwärtsrevision der Inflationsprognose erfolgte. Dies hängt im Fall der Industriegüter ohne Energie mit der im Vergleich zur Interimsprognose vom März 2024 schwächeren Nachfrage zusammen. Bei Nahrungsmitteln wurde die Prognose aufgrund der Abwärtsrevision der agrarischen Rohstoffpreise nach unten revidiert.
Die Inflationsprognose ist mit nach oben gerichteten Risiken behaftet. Sowohl geopolitische Spannungen als auch die Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas könnten zu einem höheren Preisdruck führen als prognostiziert. Auch eine stärkere und schnellere Erholung der Inlandsnachfrage würde inflationstreibend wirken.
| Inflation | |||||||
| Prognose vom Juni 2024 | Revisionen zu März 2024 | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | in Prozentpunkten | ||||||
| HVPI-Inflation | 7,7 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | –0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Nahrungsmittel insgesamt | 10,0 | 4,0 | 3,5 | 2,3 | –0,8 | 0,0 | –0,2 |
| davon unverarbeitete Nahrungsmittel | 7,6 | 2,3 | 2,7 | x | –1,0 | x | x |
| davon verarbeitete Nahrungsmittel | 10,6 | 4,4 | 3,7 | x | –0,7 | x | x |
| Industriegüter ohne Energie | 6,4 | 1,6 | 1,3 | x | –0,7 | x | x |
| Energie | 6,9 | –4,7 | –0,5 | 2,6 | –1,2 | 5,7 | 5,0 |
| Dienstleistungen | 7,8 | 5,7 | 3,7 | x | 0,4 | x | x |
| HVPI ohne Energie | 7,8 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | –0,1 | –0,5 | –0,3 |
| HVPI ohne Energie und Nahrungsmittel | 7,3 | 4,2 | 2,9 | 2,6 | 0,0 | –0,6 | –0,3 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria; 2024 bis 2026: OeNB-Prognosen vom Juni 2024 und März 2024. | |||||||
Die Inflationsdifferenz Österreichs zum Euroraum-Durchschnitt belief sich im Jahresdurchschnitt 2023 auf 2,3 Prozentpunkte. Im April 2024 betrug die Inflationsdifferenz nur mehr 1,0 Prozentpunkte. Dieser Rückgang lässt sich vor allem auf Energie, aber auch auf Industriegüter ohne Energie zurückführen. 2025 und 2026 wird die Inflationsdifferenz wieder im langfristigen Durchschnitt von 0,6 Prozentpunkten liegen (Inflationsabstand von 2011 bis 2019: 0,6 Prozentpunkte). Ein Grund für die Normalisierung der Inflationsdifferenz ist die Weitergabe der gesunkenen Großhandelspreise für Haushaltsenergie an die Endverbraucher:innen. Dies wird sich vor allem im zweiten Halbjahr 2024 verstärkt fortsetzen. Weiters wird die Dienstleistungsinflation im Jahr 2025 deutlich zurückgehen und zur Verringerung des Inflationsabstands beitragen.
6 Budgetdefizit ab 2024 wieder über der Maastricht-Grenze
2024 wird sich der Budgetsaldo von –2,7 % des BIP auf etwa –3,1 % des BIP verschlechtern (schwarze Linie in Grafik 4). Dies liegt vor allem an verzögerten negativen Effekten des Inflationsschocks auf die öffentlichen Finanzen. Insbesondere wurden die öffentlichen Gehälter und Pensionen um jeweils ca. 9,5 % erhöht, was deutlich über dem Wachstum der privaten Löhne und dem BIP-Deflator liegt. Der Effekt dieser Inflationsentwicklungen auf die Veränderung des Budgetsaldos 2024 liegt bei etwa –1 % des BIP (blaue Balken). Hinzu kommen der Effekt der schwachen Arbeitsmarktentwicklung auf die Steuereinnahmen und Zahlungen für Arbeitslosengelder (orange Balken) sowie ein Anstieg der Zinszahlungen (rosa Balken). Diese negativen Effekte kompensieren auch das Auslaufen (bzw. den Rückgang) zahlreicher expansiver Fiskalmaßnahmen im Energiebereich (weinrote Balken).
In den Jahren 2025 und 2026 wird der Budgetsaldo in etwa auf dem Niveau von 2024 verbleiben. Es laufen weiterhin expansive Fiskalmaßnahmen aus. Vor allem 2025 wird dies aber durch einen Anstieg der Zinsausgaben sowie verzögerte Effekte der in den Vorjahren sehr ungünstigen Makro- und Inflationsentwicklungen kompensiert. Die prognostizierten Budgetzahlen sind nicht kompatibel mit den wieder in Kraft tretenden europäischen Fiskalregeln: Für 2024 und 2025 erwarten wir Budgetdefizite über 3 % des BIP. Zudem liegt die unterstellte Konsolidierung 2025 und 2026 unter den voraussichtlichen Vorgaben der neuen Schuldenregel. Deshalb erscheinen zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen in den nächsten beiden Jahren notwendig; aufgrund der No-Policy-Change-Annahme sind sie aber nicht in dieser Prognose enthalten.
Die Schuldenquote wird aufgrund des hohen Wachstums des BIP-Deflators (blau schraffierte Balken in Grafik 5) 2024 leicht auf 77,3 % des BIP zurückgehen (nach 77,8 % des BIP 2023; schwarze Linie). In den Folgejahren wird sie wieder geringfügig ansteigen, weil das nominelle BIP-Wachstum insgesamt zurückgeht (Summe aus blauen und blau schraffierten Balken).
Kasten 3: Neues Fiscal Impact Measure: 2024 drückt Fiskalpolitik das Wirtschaftswachstum
Der öffentliche Sektor beeinflusst die wirtschaftliche Entwicklung, indem er entweder direkt die Endnachfrage (öffentlicher Konsum und Investitionen) steuert oder indirekt private Nachfrage (privater Konsum und Investitionen) bzw. private Produktion fördert. Das neu entwickelte Fiscal Impact Measure (FIM) der OeNB hat das Ziel, die fiskalische Position („Fiscal Stance“) in Zusammenhang mit ihren Auswirkungen auf das reale BIP-Wachstum detailliert zu betrachten. So erlaubt das FIM im Zeitverlauf einen Vergleich, wann die öffentliche Hand expansiv (wachstumsfördernd) wirkte und wann bspw. Konsolidierungsmaßnahmen zu einer restriktiven (wachstumshemmenden) fiskalischen Position geführt haben.
Um diese fiskalische Position bewerten zu können, braucht es ein Baseline-Szenario, in dem unterstellt wird, dass der Staat „neutral“ auf das Wachstum wirkt. 4 In diesem Baseline-Szenario werden für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialleistungen Abweichungen von den geltenden Indexierungs-Regeln und sonstige diskretionäre Maßnahmen herangezogen. Beispielsweise werden für die Lohn- und Einkommensteuer nur jene Steuersenkungen als expansive Maßnahmen gesehen, die über eine Abgeltung der kalten Progression hinausgehen. 5 Bei den sonstigen Ausgaben, insbesondere beim öffentlichen Konsum und den Investitionen, dient das Trend-Wachstum des BIP als neutraler Maßstab. Liegt das Wachstum des Staatskonsums über (unter) jenem des Trend-BIPs, ergibt sich hieraus ein expansiver (restriktiver) Effekt auf das Wachstum.
Der Fokus des neuen Fiscal Impact Measure liegt auf den Effekten der Fiskalpolitik auf das jährliche BIP-Wachstum. Hierfür sind vor allem Änderungen in fiskalpolitischen Instrumenten zum jeweiligen Vorjahr entscheidend. In einer solchen Betrachtungsweise war die Fiskalpolitik in den Jahren 2020 bis 2022 sehr expansiv ausgerichtet, seit 2023 ist der Kurs leicht restriktiv (linke Seite von Grafik 1 K3). Das Ausmaß der Stimulus-Maßnahmen 2020 und 2021 war außergewöhnlich groß. Deshalb ist auch eine kumulierte Betrachtung interessant. Insgesamt werden nach derzeitigem Stand gegenüber 2019 sogar 2026 noch expansive Maßnahmen von etwa 3,6 % des BIP in Kraft sein (rechte Seite von Grafik 1 K3). Allerdings hat sich über die Zeit die Struktur der Maßnahmen deutlich verändert. 2020 und 2021 war noch ein großer Teil der expansiven Maßnahmen unternehmensbezogen (insbesondere Subventionen der COFAG). Anschließend wurden vor allem die Haushaltseinkommen gestärkt, insbesondere über Pensionsanpassungen über der Inflation und einen signifikanten Rückgang der Abgabenlast auf Arbeit.
Solche Strukturverschiebungen sind für die Beurteilung der Auswirkung auf das BIP-Wachstum entscheidend, weil verschiedene Maßnahmen unterschiedlich starke Wachstumseffekte mit sich bringen: Während Eingriffe im Bereich der privaten Haushalte deutliche Wachstumseffekte über den Konsum mit sich bringen, sind diese Effekte im Bereich der Unternehmenssteuern und -subventionen geringer. Am stärksten wirken allerdings direkte Änderungen der Nachfrage über die Ausgaben für den öffentlichen Konsum und die öffentlichen Investitionen.
In Grafik 2 K3 (linke Seite) werden die im Rahmen des Fiscal Impact Measure ermittelten Wachstumseffekte der diskretionären Fiskalmaßnahmen dem Konjunkturzyklus gegenübergestellt: In den konjunkturell positiven Jahren 2017 bis 2019 war der Staatsimpuls nahe null und damit weitgehend neutral. Im ersten COVID-19-Jahr 2020 ging mit dem Wachstumseinbruch (–6,7 %) eine starke antizyklische Ausweitung der Maßnahmen zur Stützung der Haushaltseinkommen, speziell in Form der Kurzarbeitsförderung, einher. Trotz der Konjunkturerholung im folgenden Jahr blieb der Stimulus positiv, da Testungen und Impfungen zu einer starken Erhöhung des öffentlichen Konsums beitrugen. In den Folgejahren 2022 und 2023 zeigte sich wiederum eine rechnerisch neutrale Fiskalposition, die aus dem Rückgang der COVID-19-Maßnahmen (restriktiv) bei gleichzeitiger Ausweitung der Energie- und Inflationsmaßnahmen im Haushaltsbereich (expansiv) resultiert. Für 2024 erwarten wir, dass durch das Auslaufen der umfangreichen Maßnahmen der Vorjahre das BIP-Wachstum signifikant um 0,4 Prozentpunkte gebremst wird (restriktive Fiskalpolitik). Der kumulierte Effekt der seit 2020 in Kraft getretenen Maßnahmen wird aber auch 2024 noch klar positiv sein (rechte Seite von Grafik 2 K3). Unter einer No-Policy-Change-Annahme sind die wachstumsdämpfenden Effekte der Fiskalpolitik in den Jahren 2025 und 2026 nur leicht negativ.
7 Tabellenanhang
| Hauptergebnisse der Prognose | |||||||
| Juni 2024 | Revisionen zu Dez. 2023 | ||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Wirtschaftliche Aktivität | Veränderung zum Vorjahr in % (real) | ||||||
| Bruttoinlandsprodukt | –0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | –0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Privater Konsum | –0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Öffentlicher Konsum | –0,4 | –0,1 | 1,0 | 1,1 | –0,4 | 0,1 | 0,0 |
| Bruttoanlageinvestitionen | –2,2 | –1,9 | 3,0 | 2,7 | –1,7 | 0,2 | 0,5 |
| Exporte gesamt | 0,3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| Importe insgesamt | –1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,3 | –0,7 | 0,6 | 0,3 |
| in % des nominellen BIP | |||||||
| Leistungsbilanzsaldo | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
| Wachstumsbeiträge (importbereinigt) 1 | in Prozentpunkten | ||||||
| Privater Konsum | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Öffentlicher Konsum | –0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bruttoanlageinvestitionen | –0,3 | –0,3 | 0,4 | 0,3 | –0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Inlandsnachfrage (exkl. Lagerveränderung) | –0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | –0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Exporte | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|
Lagerveränderungen (inkl. statistischer
Diskrepanz) |
–0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Preise | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||
| Harmonisierter Verbraucherpreisindex | 7,7 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | –0,6 | –0,2 | 0,0 |
| Deflator des privaten Konsums | 8,1 | 3,8 | 2,4 | 2,3 | –0,1 | –0,5 | –0,2 |
| Deflator des Bruttoinlandsprodukts | 7,6 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | –0,5 | –0,3 |
| Lohnstückkosten in der Gesamtwirtschaft | 9,6 | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 0,3 | –0,4 | –0,4 |
| Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer:in | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 2,9 | 0,1 | –0,2 | 0,0 |
| Arbeitnehmerentgelt je Arbeitsstunde | 7,5 | 7,6 | 4,4 | 3,0 | 0,4 | –0,3 | –0,2 |
| Importpreise | 0,0 | –0,1 | 2,3 | 2,2 | –1,8 | –0,1 | 0,0 |
| Exportpreise | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | –0,2 | –0,2 | –0,1 |
| Terms-of-Trade | 2,5 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | –0,1 | –0,1 |
| Einkommen und Sparen | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||
| Real verfügbares Haushaltseinkommen | –0,2 | 3,0 | 2,4 | 1,1 | –0,8 | –0,2 | –0,2 |
| in % des nominellen verfügbaren Haushaltseinkommens | |||||||
| Sparquote | 9,0 | 10,3 | 10,5 | 10,1 | 2,1 | 1,6 | 1,1 |
| Arbeitsmarkt | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||
| Unselbstständig Beschäftigte | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | –0,3 | –0,1 | –0,1 |
| Arbeitsstunden (Arbeitnehmer:innen) | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | –0,6 | 0,0 | 0,1 |
| in % des Arbeitskräfteangebots | |||||||
| Arbeitslosenquote gemäß Eurostat | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | –0,2 | –0,2 | –0,2 |
| Arbeitslosenquote gemäß AMS | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | –0,1 | –0,1 | –0,2 |
| Budget | in % des nominellen BIP | ||||||
| Budgetsaldo (Maastricht) | –2,7 | –3,1 | –3,3 | –3,0 | –0,4 | –0,4 | –0,2 |
| Staatsverschuldung | 77,8 | 77,3 | 77,6 | 78,2 | 0,9 | 2,0 | 2,6 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognosen vom Juni 2024 und Dezember 2023. | |||||||
|
1
Die importbereinigten Wachstumsbeiträge
wurden errechnet, indem von der jeweiligen
Endnachfragekomponente die zugeordneten Importe abgezogen wurden. Diese wurden auf der Basis von Input-Output-Tabellen berechnet. |
|||||||
| Internationale Rahmenbedingungen der Prognose | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Bruttoinlandsprodukt | Veränderung zum Vorjahr in % (real) | |||
| Welt ohne Euroraum | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| USA | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
| China | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,8 |
| Indien | 7,7 | 7,0 | 6,6 | 6,6 |
| Japan | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
| Lateinamerika | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 2,6 |
| Vereinigtes Königreich | 0,1 | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
| Neue EU-Mitgliedstaaten 1 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 1,7 |
| Schweiz | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
| Euroraum 2 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
| Welthandel (Importe i. w. S.) | Veränderung zum Vorjahr in % (real) | |||
| Welt | 0,4 | 2,1 | 3,3 | 3,2 |
| Welt außerhalb des Euroraums | 1,0 | 2,6 | 3,3 | 3,3 |
| Wachstum der Exportmärkte des Euroraums (real) | 0,8 | 2,1 | 3,4 | 3,3 |
| Wachstum der österreichischen Exportmärkte (real) | –1,1 | 1,2 | 3,4 | 3,3 |
| Preise | ||||
| Erdölpreis in USD/Barrel Brent | 83,7 | 83,8 | 78,0 | 74,5 |
| Drei-Monats-Zinssatz in % | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,5 |
| Langfristiger Zinssatz in % | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| USD/EUR-Wechselkurs | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|
Nominell-effektiver Wechselkurs des Euro
(Euroraum-Index) |
121,8 | 124,0 | 124,2 | 124,2 |
| Quelle: Eurosystem. | ||||
| 1 Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn. | ||||
| 2 2023: Eurostat; 2024 bis 2026: Ergebnis der Juni-Projektion 2024 des Eurosystems. | ||||
| Außenhandel | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Exporte | Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Internationale Wettbewerberpreise | –2,2 | 0,4 | 2,6 | 2,3 |
| Exportdeflator | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
| Entwicklung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit | –4,6 | –2,0 | –0,2 | 0,0 |
| Nachfrage auf öst. Exportmärkten | –1,1 | 1,2 | 3,4 | 3,3 |
| Österreichische Exporte i. w. S. (real) | 0,3 | 1,5 | 2,6 | 2,9 |
| Marktanteile Österreichs | 1,3 | 0,3 | –0,8 | –0,4 |
| Importe | Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Internationale Wettbewerberpreise | –0,7 | 0,5 | 2,6 | 2,3 |
| Importdeflator | 0,0 | –0,1 | 2,3 | 2,2 |
| Österreichische Importe i. w. S. (real) | –1,4 | 1,5 | 3,2 | 3,3 |
| Terms-of-Trade | 2,5 | 2,4 | 0,5 | 0,1 |
| in Prozentpunkten des realen BIP | ||||
| Beiträge der Nettoexporte zum BIP-Wachstum | 1,0 | 0,1 | –0,2 | –0,1 |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Exportquote | 59,8 | 58,7 | 59,0 | 59,7 |
| Importquote | 56,8 | 54,4 | 54,8 | 55,6 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
| Leistungsbilanz | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Handelsbilanz | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| Güterbilanz | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Dienstleistungsbilanz | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Primäreinkommensbilanz 1 | –0,3 | –0,3 | –0,3 | –0,3 |
| Sekundäreinkommensbilanz 2 | –0,6 | –0,6 | –0,6 | –0,6 |
| Leistungsbilanz | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
|
Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026:
OeNB-Prognose
vom Juni 2024. |
||||
|
1
Bilanz der Erwerbs- und
Vermögenseinkommen (Arbeitsentgelte,
Einkommen aus Vermögensanlagen u. a.). |
||||
| 2 Bilanz der laufenden Transfers. | ||||
| Einkommen und Konsum der privaten Haushalte | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Unselbstständig Beschäftigte | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| Löhne je beschäftigter Person | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 2,9 |
| Arbeitnehmerentgelt | 9,0 | 8,2 | 5,2 | 3,9 |
| Vermögenseinkommen | 7,2 | –10,5 | 2,1 | 1,7 |
|
Selbstständigeneink. und
Betriebsüberschüsse |
1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
|
Beiträge zum Wachstum des
verfügbaren Haushaltseinkommens in Prozentpunkten |
||||
| Arbeitnehmerentgelt | 7,8 | 7,2 | 4,6 | 3,5 |
| Vermögenseinkommen | 0,7 | –1,0 | 0,2 | 0,1 |
| Selbstständigeneink. und Betriebsüberschüsse | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Nettotransfers abzüglich direkter Steuern 1 | –0,7 | 0,1 | 0,0 | –0,4 |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Verfügbares Haushaltseinkommen (nominell) | 7,9 | 6,9 | 4,9 | 3,5 |
| Konsumdeflator | 8,1 | 3,8 | 2,4 | 2,3 |
| Verfügbares Haushaltseinkommen (real) | –0,2 | 3,0 | 2,4 | 1,1 |
| Privater Konsum (real) | –0,2 | 1,5 | 2,2 | 1,6 |
|
in % des verfügbaren
Haushaltseinkommens |
||||
| Sparquote | 9,0 | 10,3 | 10,5 | 10,1 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
|
1
Negative Werte bedeuten eine Zunahme
der (negativen) Nettotransfers
abzüglich direkter Steuern, positive Werte eine Abnahme. |
||||
| Investitionen | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in % | ||||
| Bruttoanlageinvestitionen (real) | –2,2 | –1,9 | 3,0 | 2,7 |
| davon: | ||||
| Ausrüstungsinvestitionen | –2,1 | –2,3 | 2,3 | 2,6 |
| Wohnbauinvestitionen | –8,8 | –5,6 | 5,0 | 2,9 |
| Tiefbau- und andere Investitionen | –2,3 | –1,9 | 2,5 | 1,5 |
| Investitionen in Forschung und Entwicklung | 3,8 | 0,6 | 3,4 | 3,8 |
| Öffentliche Investitionen | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Private Investitionen | –3,4 | –2,3 | 3,4 | 3,0 |
| Beiträge zum Wachstum der realen Bruttoanlageinvestitionen | in Prozentpunkten | |||
| Ausrüstungsinvestitionen | –0,7 | –0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Wohnbauinvestitionen | –1,8 | –1,0 | 0,9 | 0,5 |
| Tiefbau- und andere Investitionen | –0,5 | –0,4 | 0,6 | 0,3 |
| Investitionen in Forschung und Entwicklung | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
| Beiträge zum Wachstum des realen BIP | in Prozentpunkten | |||
| Bruttoanlageinvestitionen, insgesamt | –0,6 | –0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Lagerveränderungen | –0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Investitionsquote | 24,4 | 23,4 | 23,6 | 23,9 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
| Arbeitsmarkt | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Beschäftigung | Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Gesamtbeschäftigung (Personen) | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,9 |
| Unselbstständig Beschäftigte (Personen) | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| davon: öffentlich Beschäftigte | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 |
| Selbstständig Beschäftigte (Personen) | –0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Geleistete Arbeitsstunden, insgesamt | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| Unselbstständig Beschäftigte (Stunden) | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| Selbstständig Beschäftigte (Stunden) | –0,9 | –1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbeitskräfteangebot | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Vorgemerkte Arbeitslose | 9,0 | 7,2 | –2,0 | –1,9 |
| Arbeitslosenquote | in % des Arbeitskräfteangebots | |||
| gemäß Eurostat | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 |
| gemäß AMS | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,3 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
| Arbeitnehmerentgelte | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Bruttolohnsumme 1 | Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Nominell | 9,0 | 8,2 | 5,2 | 3,9 |
| Konsumdeflator | 8,1 | 3,8 | 2,4 | 2,3 |
| Real | 0,9 | 4,4 | 2,8 | 1,6 |
| Kollektivvertragslöhne 1 | 7,6 | 8,3 | 4,0 | 2,8 |
| Lohndrift | 0,2 | –0,7 | 0,2 | 0,1 |
| Arbeitnehmerentgelt pro beschäftigter Person | ||||
| Brutto 2 , nominell | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 2,9 |
| Brutto, real (Konsumdeflator) | –0,4 | 3,7 | 1,7 | 0,6 |
| Netto 3 , real (Konsumdeflator) | 0,3 | 4,4 | 1,9 | 0,4 |
| Arbeitnehmerentgelt je Stunde | ||||
| Brutto, nominell | 7,5 | 7,6 | 4,4 | 3,0 |
| Brutto, real (Konsumdeflator) | –0,5 | 3,6 | 2,0 | 0,6 |
| in % des nominellen BIP | ||||
| Lohnquote | 49,6 | 50,7 | 50,8 | 50,7 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
|
1
Gesamtwirtschaft.
2
Inkl.
Dienstgeberbeiträgen.
3 Nach Abzug von Steuern und SV-Beiträgen. |
||||
| Preise | ||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| HVPI und Komponenten | Veränderung zum Vorjahr in % | |||
| Gesamtindex | 7,7 | 3,4 | 2,7 | 2,5 |
| Nahrungsmittel | 10,0 | 4,0 | 3,5 | 2,3 |
| Unverarbeitete Nahrungsmittel | 7,6 | 2,3 | 2,7 | x |
| Verarbeitete Nahrungsmittel | 10,6 | 4,4 | 3,7 | x |
| Industriegüter ohne Energie | 6,4 | 1,6 | 1,3 | x |
| Energie | 6,9 | –4,7 | –0,5 | 2,6 |
| Elektrizität | –3,5 | 2,2 | 18,4 | 0,8 |
| Gas | 54,2 | –12,1 | –0,8 | 4,0 |
| Flüssige Brennstoffe | –9,2 | –2,4 | –8,3 | –3,0 |
| Dienstleistungen | 7,8 | 5,7 | 3,7 | x |
| HVPI ohne Energie | 7,8 | 4,2 | 3,0 | 2,5 |
| HVPI ohne Energie und Nahrungsmittel | 7,3 | 4,2 | 2,9 | 2,6 |
| Deflatoren der VGR | ||||
| Deflator des privaten Konsums | 8,1 | 3,8 | 2,4 | 2,3 |
| Investitionsdeflator | 5,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 |
| Importdeflator | 0,0 | –0,1 | 2,3 | 2,2 |
| Exportdeflator | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
| Terms-of-Trade | 2,5 | 2,4 | 0,5 | 0,1 |
| BIP-Deflator zu Faktorkosten | 8,2 | 4,8 | 3,1 | 2,4 |
| Quelle: 2023: Statistik Austria, 2024 bis 2026: OeNB-Prognose vom Juni 2024. | ||||
| Aufteilung der Prognoserevisionen seit Dezember 2023 | ||||||
| BIP | HVPI | |||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Veränderung zum Vorjahr in %, Prozentpunkte | ||||||
| Prognose vom Juni 2024 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 3,4 | 2,7 | 2,5 |
| Prognose vom Dezember 2023 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| Differenz | –0,3 | 0,1 | 0,3 | –0,6 | –0,2 | 0,0 |
| Verursacht durch: | in Prozentpunkten | |||||
| Externe Annahmen | –0,1 | 0,1 | 0,2 | –0,3 | –0,2 | 0,0 |
| Neue Daten 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
| davon: Revision historischer Daten bis Q3 23 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prognosefehler für Q4 23 und Q1 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Sonstiges 2 | –0,3 | 0,1 | 0,1 | –0,2 | 0,0 | 0,0 |
|
Quelle: OeNB-Prognosen vom Dezember 2023 und Juni
2024. Aufgrund von Rundungsdifferenzen
können die Differenz und die Summe der Wachstumsbeiträge aus den einzelnen Revisionen von der Gesamtrevision abweichen. |
||||||
|
1
„Neue Daten" bezieht sich auf gegenüber
der letzten Prognose neu vorliegende Daten für das
BIP-Wachstum bzw. die Inflation. |
||||||
|
2
Unterschiedliche Annahmen über die
Entwicklung heimischer Variablen wie Löhne,
öffentlicher Konsum, Effekte steuerlicher Maßnahmen, sonstige Änderungen der Einschätzung, Modelländerungen. |
||||||
| Vergleich der aktuellen Wirtschaftsprognosen für Österreich | |||||||||||||
| OeNB | WIFO | IHS | OECD | IWF |
EU-
Kom- mission |
||||||||
| Juni 2024 | März 2024 | März 2024 | Mai 2024 | April 2024 | Mai 2024 | ||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Hauptergebnisse | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||
| BIP (real) | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 1,6 |
| Privater Konsum (real) | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 1,9 | x | x | 1,3 | 2,0 |
| Öffentlicher Konsum (real) | –0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | x | x | 0,1 | 0,5 |
| Bruttoanlageinvestitionen (real) | –1,9 | 3,0 | 2,7 | –2,0 | 2,2 | –0,8 | 1,9 | –0,4 | 1,2 | x | x | –2,2 | 2,3 |
| Exporte (real) | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 1,2 | 3,3 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 3,0 | 1,2 | 2,4 |
| Importe (real) | 1,5 | 3,2 | 3,3 | 1,6 | 3,5 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 1,0 | 2,7 |
| Arbeitsproduktivität 1 | –0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | x | x | –0,1 | 0,9 |
| BIP-Deflator | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 4,4 | 2,6 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 2,8 | 3,9 | 2,7 | 4,1 | 2,6 |
| VPI | x | x | x | 3,8 | 2,7 | 3,5 | 2,6 | x | x | x | x | x | x |
| HVPI | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 3,7 | 2,9 | 3,9 | 2,8 | 3,6 | 2,8 |
| Lohnstückkosten | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 8,0 | 3,3 | 7,3 | 2,8 | 6,7 | 2,5 | x | x | 7,2 | 2,3 |
| Beschäftigte 2 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
| in % des Arbeitskräfteangebots | |||||||||||||
| Arbeitslosenquote 3 gem. Eurostat | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
| in % des nominellen BIP | |||||||||||||
| Leistungsbilanz | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | x | x | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| Budgetsaldo (Maastricht) | –3,1 | –3,3 | –3,0 | –2,9 | –2,7 | –2,2 | –2,1 | –2,8 | –2,7 | –2,6 | –2,3 | –3,1 | –2,9 |
| Prognoseannahmen | |||||||||||||
| Erdölpreis in USD/Barrel Brent | 83,8 | 78,0 | 74,5 | 80,0 | 75,0 | 81,2 | 75,7 | 84,6 | 85,0 | 78,6 | 73,7 | 85,4 | 80,0 |
| Kurzfristiger Zinssatz in % | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 2,8 |
| USD/EUR-Wechselkurs | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| BIP real, Euroraum | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,4 |
| BIP real, USA | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 2,1 |
| BIP real, Welt | 3,0 | 3,0 | 3,0 | x | x | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Welthandel 3 | 2,1 | 3,3 | 3,2 | x | x | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 3,4 |
| Quelle: OeNB, WIFO, IHS, OECD, IWF, Europäische Kommission. Anmerkung: x = keine Daten vorhanden. | |||||||||||||
| 1 OeNB, WIFO: BIP je geleisteter Arbeitsstunde. IHS, OECD, EU-Kommission: BIP je beschäftigter Person. | |||||||||||||
| 2 WIFO und IHS: Unselbstständig aktiv Beschäftigte. | |||||||||||||
| 3 IHS: Waren laut CPB. | |||||||||||||
| Quartalsverlauf der Prognoseergebnisse | |||||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
| Preise, Löhne, Kosten | Veränderung zum Vorjahr in % | ||||||||||||||
| HVPI | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
| HVPI ohne Energie | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 4,9 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,3 |
| Deflator des privaten Konsums | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 5,3 | 4,2 | 2,9 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Deflator der Bruttoanlageinvestitionen | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| BIP-Deflator | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Lohnstückkosten | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 9,3 | 8,4 | 7,2 | 6,3 | 4,5 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
| Löhne pro beschäftigter Person, nominell | 7,7 | 4,2 | 2,9 | 7,5 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 5,5 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |
| Produktivität | –0,1 | 0,8 | 0,6 | –1,7 | –0,1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Löhne pro beschäftigter Person, real | 3,7 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | 3,8 | 4,7 | 4,3 | 3,2 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Importdeflator | –0,1 | 2,3 | 2,2 | –1,7 | –0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 |
| Exportdeflator | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Terms-of-Trade | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 3,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Wirtschaftliche Aktivität | real, Veränderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in % | ||||||||||||||
| BIP | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Privater Konsum | 1,5 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Öffentlicher Konsum | –0,1 | 1,0 | 1,1 | –1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | –0,3 | –0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bruttoanlageinvestitionen | –1,9 | 3,0 | 2,7 | –2,7 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Exporte | 1,5 | 2,6 | 2,9 | –0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Importe | 1,5 | 3,2 | 3,3 | –1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Beiträge zum Wachstum des realen BIP in Prozentpunkten | |||||||||||||||
| Inlandsnachfrage | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Nettoexporte | 0,2 | 0,7 | 0,6 | –0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Lagerveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbeitsmarkt | in % des Arbeitskräfteangebots | ||||||||||||||
| Arbeitslosenquote gemäß Eurostat | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| Veränderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in % | |||||||||||||||
| Gesamtbeschäftigung | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| davon: Privater Sektor | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Unselbstständig Beschäftigte | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Zusätzliche Variablen | real, Veränderung zum Vorjahr (Jahreswerte) bzw. zum Vorquartal (Quartalswerte) in % | ||||||||||||||
| Verfügbares Haushaltseinkommen | 3,0 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| in % des realen BIP | |||||||||||||||
| Output-Gap | –0,9 | –0,3 | 0,0 | –1,0 | –1,1 | –0,9 | –0,7 | –0,5 | –0,3 | –0,2 | –0,1 | –0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Quelle: Statistik Austria und OeNB-Prognose vom Juni 2024. Quartalswerte saison- und arbeitstägig bereinigt. | |||||||||||||||
-
Oesterreichische Nationalbank, Referat Konjunktur, friedrich.fritzer@oenb.at , mathias.moser@oenb.at, doris.prammer@oenb.at , christian.ragacs@oenb.at , lukas.reiss@oenb.at , richard.sellner@oenb.at , alfred.stiglbauer@oenb.at und klaus.vondra@oenb.at . Unter Mitarbeit von Gerhard Fenz, Birgit Niessner und Beate Resch. Die Prognose basiert auf Daten bis zum 21.5.2024. ↩︎
-
Der Kurzfristprognose liegt ein dynamisches Faktormodell zugrunde. Die Kurzdokumentation über die Modellmethodik findet sich hier . ↩︎
-
In dieser Berechnung sind nur direkte Effekte einbezogen. ↩︎
-
Eine neutrale Wachstumsposition impliziert jedoch nicht notwendigerweise einen konstanten zyklisch bereinigten Primärsaldo, da die neutralen Wachstumsraten für Einnahmen und Ausgaben voneinander abweichen können. ↩︎
-
Die Tarifstufen und Absetzbeträge der Einkommensteuer sowie die wichtigsten Familienleistungen werden erst seit 2023 automatisch an die Inflation indexiert (und das Pflegegeld seit 2020). Zur Erhöhung der Vergleichbarkeit wurde deshalb die kalte Progression bzw. inflationsbedingte Entwertung von Sozialleistungen vor der Einführung der Indexierung von den diskretionären Maßnahmen abgezogen. ↩︎