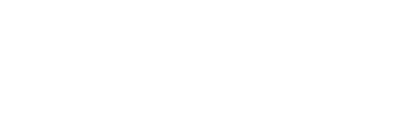OeNB Report 2025/5: Österreichs Wirtschaft stabilisiert sich 2025
Redaktionsschluss: 14. März 2025
Gerhard Fenz, Bernhard Graf, Doris Prammer, Lukas Reiss, Martin Schneider, Richard Sellner, Alfred Stiglbauer und Klaus Vondra 1
1 Zusammenfassung
Die heimische Konjunktur wird sich 2025 stabilisieren, jedoch erst 2026 merklich wachsen. Nach zweieinhalb Jahren mit negativem Wirtschaftswachstum werden die wirtschaftlichen Bremsfaktoren 2025 schwächer: Die Inflation stabilisiert sich bei 2,9 %, sinkende Zinsen reduzieren die Finanzierungskosten. Damit nimmt der Kostendruck auf Unternehmen und private Haushalte ab. Dies spiegelt sich in steigenden Vertrauenswerten von Industrie und Konsument:innen zu Jahresbeginn. Dazu tragen verbesserte Wachstumsaussichten auf wichtigen Absatzmärkten wie Deutschland maßgeblich bei. Deshalb kommt es im zweiten Halbjahr 2025 zu einer merklichen Konjunkturerholung. Aufgrund des schlechten Startwertes ergibt sich für das Gesamtjahr 2025 jedoch nur eine Stagnation der Wirtschaftsleistung (–0,1 %). In den beiden Folgejahren setzt sich der Aufschwung fort, sodass Wachstumsraten von jährlich 1,2 % erreicht werden.
Der Arbeitsmarkt hat sich angesichts der Konjunkturschwäche als sehr robust erwiesen. Die Arbeitslosigkeit ist nur moderat gestiegen, wird sich 2025 aber weiter erhöhen. Die konjunkturelle Erholung wird erst ab 2026 kräftig genug sein, um die Arbeitslosigkeit wieder zu senken.
Der deutliche Inflationsrückgang im Lauf des Jahres 2024 wurde im Jänner 2025 abrupt gestoppt. Die Inflationsrate stieg deutlich – allen voran die Energieinflation. Das Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen im Energiebereich (z. B. Strompreisbremse), die Erhöhung der Netzkosten für Strom und Gas sowie der Anstieg des CO2-Preises erhöhten die Preise für Haushalts-Energie im Jänner 2025 merklich.
Die gestiegene Energieinflation und die weiterhin hohe Dienstleistungsinflation bilden sich nur langsam zurück. Deshalb erwartet die OeNB eine HVPI-Inflationsrate für 2025 von 2,9 % – genauso hoch wie 2024. Erst 2026 sinken Energie- und Dienstleistungsinflation merklich, sodass die HVPI-Inflation 2026 2,3 % beträgt. 2027 nähert sie sich mit 2,1 % wieder dem Zielwert des Eurosystems von 2 % an.
Die OeNB erwartet 2025 nur eine geringfügige Verbesserung des Budgetdefizits auf 3,8 % des BIP. Damit wird die Maastricht-Grenze von 3 % überschritten, die zur Vermeidung eines Defizitverfahrens eingehalten werden müsste. Die OeNB schätzt das Konsolidierungsvolumen 2025 durch das Paket der neuen Bundesregierung auf ca. 4 Mrd EUR. Die Budgetkonsolidierung wird aber durch die schwache Wirtschaftsentwicklung erschwert: Sie dämpft das Wachstum der Steuereinnahmen und erhöht die Ausgaben im Arbeitsmarktbudget. 2026 werden weitere Konsolidierungsmaßnahmen, die bereits 2025 in Kraft traten, wirksam. Zudem leistet das Wirtschaftswachstum 2026 und 2027 wieder einen positiven Beitrag. Deshalb liegt das Budgetdefizit 2027 mit 3,1 % nur noch knapp über der Maastricht-Grenze.
Im Vergleich zur OeNB-Prognose vom Dezember 2024 hat sich der Ausblick auf die Jahre 2025 bis 2027 deutlich verschlechtert. Das Wirtschaftswachstum für 2025 wird nun um 0,9 Prozentpunkte geringer angenommen, die Inflation um 0,5 Prozentpunkte höher geschätzt. Grund dafür ist vor allem die wesentlich schlechtere Ausgangslage, die sich anhand der inzwischen realisierten Werte für Ende 2024 und Anfang 2025 ergibt. Die Risiken für die Prognose sind groß: Etwaige US-Zölle und Gegenzölle verringern das Wachstum und erhöhen die Inflation. Mögliche zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen verbessern zwar den Budgetsaldo, haben aber negative Effekte auf das Wachstum. Lediglich die vermehrten Infrastrukturausgaben Deutschlands werden auch Österreichs Wachstum ankurbeln.
Tabelle 1
| OeNB-Interimsprognose für Österreich vom März 2025 | |||||||||||
|
Revision seit
Dez. 2024 |
|||||||||||
| Q1 25 | Q2 25 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| in Prozentpunkten | |||||||||||
|
Reales BIP-Wachstum
(zur Vorperiode in %) |
0,0 | 0,2 | –1,3 | –0,1 | 1,2 | 1,2 | –0,9 | –0,4 | –0,1 | ||
| HVPI-Inflation (zum Vorjahr in %) | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | ||
| AMS-Arbeitslosenquote (in %) | 7,4 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||
| Quelle: 2024: Statistik Austria; 2025–2027: OeNB. | |||||||||||
2 Längste wirtschaftliche Schwächephase der Zweiten Republik nimmt ein Ende
Österreichs Wirtschaft befindet sich in der längsten Schwächephase der Zweiten Republik. In den letzten zweieinhalb Jahren sank die Wirtschaftsleistung um insgesamt 3,3 %. Nach einem Rückgang von 0,9 % 2023 (real, saison- und arbeitstägig bereinigt) ging sie 2024 um weitere 1,3 % zurück. Im Gegensatz dazu sank sie in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise (vom zweiten Quartal 2008 bis zum zweiten Quartal 2009) innerhalb von fünf Quartalen um 5,1 %. Die Folgen der COVID-19-Pandemie führten zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 6,9 % innerhalb von sechs Quartalen (vom vierten Quartal 2019 bis zum vierten Quartal 2021). Die aktuelle Rezession ist daher nicht besonders tief, aber sie dauert überdurchschnittlich lange an.
Grafik 1
Die derzeitige Schwächephase ist von zwei entscheidenden Entwicklungen geprägt: einer Konsumschwäche und der Industrierezession. Einerseits verbuchten der private Konsum und spiegelbildlich der Handel, der Dienstleistungsbereich und die Freizeitwirtschaft keine ausgeprägten Zuwächse.
Betrachtet man die realen (saisonbereinigten) Konsumausgaben für den Individualverbrauch, so konnten seit Rezessionsbeginn nur die Bereiche Wohnen und Freizeit einen Zuwachs verzeichnen. Alle anderen Komponenten, speziell Konsumgüter mit mittlerer oder langer Lebensdauer verbuchten reale Rückgänge. Dies erscheint vor dem Hintergrund eines beinahe kontinuierlich gestiegenen real verfügbaren Haushaltseinkommens überraschend. Die Konsumzurückhaltung geht mit einer gestiegenen Sparquote einher. Diese lag 2024 wieder auf dem Niveau von 2021 – somit einem Zeitraum, in dem die Möglichkeiten zum Konsum für Haushalte stark eingeschränkt waren.
Grafik 2a
Grafik 2b
Für den Anstieg der Sparquote gibt es eine Reihe von Ursachen (siehe OeNB-Prognose vom Dezember 2024 für eine detaillierte Darstellung): Dazu zählen u. a. der Anstieg der Zinsen und hohe einmalige Transferzahlungen. Ein weiterer Grund könnte in der Entwertung der realen Finanzvermögen liegen. Eine einfache, lineare Fortschreibung des Anstiegs der realen Finanzvermögen der privaten Haushalte der Jahre 2012 bis 2019 zeigt erstens den Anstieg während der Pandemiejahre, aber zweitens, dass der Inflationsschock der Jahre 2022/23 zu einem deutlichen Rückgang bzw. einer Entwertung der Finanzvermögen geführt hat. Diese lagen Ende 2024 weiterhin mehr als 10 % unter der Trendfortschreibung. Trotz hoher Sparquote konnte dieser Verlust bisher nicht wettgemacht werden.
Andererseits steckt die heimische Wirtschaft in einer hartnäckigen Industrierezession. Die restriktive Geldpolitik, die schwache Nachfrage wichtiger Handelspartner, der Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit und hohe politische Risiken (Zölle) dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung im Industriesektor. Diese Faktoren spiegeln sich in einem ausgeprägten Rückgang der Sachgütererzeugung (–12 % seit dem vierten Quartal 2022 laut Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (VGR)) sowie rückläufigen Investitionen (–6 %, laut VGR) und Güterexporten (–12 %) wider. Die weitere konjunkturelle Entwicklung in Österreich ist maßgeblich davon abhängig, ob die Industrierezession zu einem Ende kommt. Wesentliche Bremsfaktoren der letzten Zeit verlieren etwas an Bedeutung: Die HVPI-Inflation hat sich stabilisiert, das Lohnwachstum geht 2025 deutlich zurück. Die negativen Effekte der restriktiven Geldpolitik werden durch die zuletzt vollzogenen Zinssenkungen schwächer. Somit mehren sich zu Jahresbeginn die Anzeichen einer Bodenbildung der österreichischen Industrie. Die im März 2025 veröffentlichten Produktionsdaten beinhalteten eine deutliche Aufwärtsrevision der Industrieproduktion für Dezember 2024 (Eurostat B–D, ohne D353; +1,1 % anstatt zuvor –3,4 %, saisonbereinigt, im Vergleich zum November 2024) und eine starke Entwicklung im Jänner 2025 (+4,4 %).
Diese Aufwärtsrevision zeigt sich u. a. in den Kernbereichen der österreichischen Industrie, dem Maschinenbau und der Metallerzeugung. Diese beiden Bereiche machen zusammen rund ein Fünftel gesamten Industrieproduktion inkl. Bau aus.
Grafik 3
Die Aufwärtsrevision deckt sich auch mit den Umfrageergebnissen des EinkaufsManagerIndex 2 und des Industrievertrauens im Rahmen der Economic-Sentiment-Indicator-Umfrage (ESI) 3 . Beide befinden sich zwar weiterhin unter ihrem langfristigen Durchschnitt, haben sich aber zu Jahresanfang deutlich verbessert. Auch die Produktionserwartungen (ESI) im Maschinenbau und in der Metallerzeugung sind im Februar 2025 angestiegen – sie sind jedoch von einem sehr volatilen Profil gekennzeichnet. Die Lkw-Fahrleistung, ein beständig guter Indikator für die Produktionsleistung in Österreich, ist zu Jahresende 2024 weniger stark zurückgegangen (–1,5 % im zweiten Quartal 2024, –0,5 % im dritten Quartal und –0,3 % im vierten Quartal; jeweils im Vorquartalsvergleich) und zu Jahresbeginn 2025 leicht gestiegen.
Ein weiteres Indiz für ein Auslaufen der Industrierezession in Österreich sind der schwächer werdende Anstieg der arbeitslos gemeldeten Leiharbeiter:innen und damit verbunden eine weniger stark rückläufige Beschäftigungsentwicklung dieser Gruppe zu Jahresende 2024. In Summe gibt es somit sowohl bei den Vertrauens- und Industrieindikatoren als auch am Arbeitsmarkt erste Hinweise für eine Trendwende.
Die Konjunkturschwäche hat bisher nur geringe Folgen für den österreichischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten gemäß Registerdaten ist nach leichten Rückgängen zu Jahresmitte im vierten Quartal deutlich gewachsen (+0,4 %) und lag im Gesamtjahr 2024 geringfügig über dem Niveau von 2023 (+0,1 %). Dahinter steht ein Anstieg bei der Beschäftigung von Frauen (+0,8 %; bei Männern gibt es einen Rückgang von 0,5 %), von ausländischen Arbeits-tätigen (+2,6 %; bei österreichischen Staatsbürger:innen gibt es einen Rückgang von 0,7 %), sowie von älteren Arbeitnehmer:innen (älter als 55 Jahre: +4,1 %; bei den 15- bis 24-Jährigen gibt es einen Rückgang von 1,5 %). Sektoral kam es zu einer Verschiebung von der Industrie (Waren-produktion: –8.800 Beschäftigte, Bau: –8.300) und den privaten Dienstleistungen (–1.900) hin zu öffentlichen Dienstleistungen mit einem Plus von 26.000 Beschäftigten.
Die Register-Arbeitslosigkeit stieg im ersten Halbjahr 2024 um 27.000 Personen an, verharrte im weiteren Jahresverlauf jedoch auf diesem Niveau. Anstiege wurden sowohl in der Industrie als auch bei privaten und öffentlichen Dienstleistungen verzeichnet. Die saisonbereinigte AMS-Arbeitslosenquote stieg von 6,6 % im vierten Quartal 2023 auf 7,2 % im dritten Quartal 2024 und blieb seither (bis inkl. Februar 2025) bei diesem Wert. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet die OeNB mit einem Anstieg auf durchschnittlich 7,4 %. In den Folgejahren wird sie aber auf 7,3 % bzw. 7,1 % zurückgehen. Dies entspricht einer leichten Aufwärtsrevision im Vergleich zur OeNB-Prognose vom Dezember 2024.
3 Konjunkturindikator zeigt Stabilisierung zu Jahresbeginn 2025
Nach dem überraschend starken BIP-Rückgang im vierten Quartal 2024 um 0,4 % zeigt der OeNB-Konjunkturindikator 4 (Stand: 14. März 2025) für das erste Quartal 2025 einen leichten Anstieg des realen BIP um 0,1 % und für das zweite Quartal 2025 einen weiteren Anstieg um 0,3 % an.
Diese Verbesserung der reinen Modellprognose für die erste Jahreshälfte 2025 wird durch die Verbesserung der Stimmungsindikatoren für Industrie, Dienstleistungen, sowie Einzelhandel und der Lkw-Fahrleistung getrieben. Der OeNB-Konjunkturindikator deutet somit auf eine Stabilisierung der Wirtschaftsleistung hin, nach zuletzt anhaltenden Rückgängen.
Die gestiegene Unsicherheit in Bezug auf die globale Handels- und Zollpolitik stellt jedoch ein beträchtliches Abwärtsrisiko für den außenwirtschaftlichen Beitrag zum Wachstum des realen BIP dar. Um diese – nicht explizit im Modell erfassten – Entwicklungen darzustellen, wird den Wachstumsraten im ersten und zweiten Quartal 2025 ein Expert Judgment von jeweils 0,1 Prozentpunkten abgeschlagen.
Grafik 4
4 Deutliche Abwärtsrevision der Wachstumsprognose 2025
Die Wachstumsprognose für die Jahre 2025 bis 2027 stellt ein erweitertes technisches Update der OeNB-Prognose vom Dezember 2024 dar. Dazu wurde zunächst die aktuelle Veröffentlichung der VGR für das vierte Quartal 2024 inkludiert. Anschließend kam es zu einer Simulation der Auswirkungen der Veränderungen (seit Dezember 2024) in den internationalen Rahmenbedingungen (wie Energie- und Rohstoffpreise, Wechselkurse und Zinsen) mit dem makroökonomischen Modell der OeNB (Austrian Quarterly Model – AQM). Im nächsten Schritt wurden die Auswirkungen des Konsolidierungspakets der neuen Bundesregierung berücksichtigt und zuletzt die Ergebnisse des OeNB-Konjunkturindikators für das erste Halbjahr 2025 übernommen. Darauf aufbauend wurde die Wachstumseinschätzung bis inkl. des zweiten Quartals 2026 aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen hinsichtlich der globalen Zoll- und Handelspolitik angepasst.
Grafik 5
Verglichen mit der OeNB-Prognose vom Dezember 2024 wird die Prognose für das reale BIP-Wachstum im Jahr 2025 um 0,9 Prozentpunkte auf –0,1 % gesenkt. Österreich ist damit das dritte Jahr in Folge in einer – wenn auch schwachen – Rezession. Diese Abwärtsrevision ist (1) auf einen schwächeren historischen BIP-Verlauf und den unterschätzten BIP-Rückgang im vierten Quartal 2024 (VGR-Rechnung: –0,4 Prozentpunkte), (2) auf Revisionen der externen Annahmen seit Dezember 2024 (–0,1 Prozentpunkte), (3) auf das Konsolidierungspaket (–0,2 Prozentpunkte) und (4) auf eine nunmehr schwächere Einschätzung für das BIP-Wachstum bis inkl. dem ersten Halbjahr 2026 zurückzuführen. Letzteres ist auch der Hauptgrund für die Abwärtsrevision der Wachstumsprognose für 2026 um 0,4 Prozentpunkte auf 1,2 %. Im Jahr 2027 wird die Wachstumsprognose um 0,1 Prozentpunkt auf 1,2 % nach unten korrigiert. Dies folgt dem etwas schwächeren externen Umfeld.
Kasten 1: Budgetdefizit bleibt 2025 trotz Konsolidierung deutlich über 3 % des BIP
2025 verbessert sich der Budgetsaldo nur geringfügig auf –3,8 % des BIP (schwarze Linie in Grafik K1). Damit wird die Maastricht-Grenze von 3 % überschritten, die zur Vermeidung eines Defizitverfahrens eingehalten werden müsste. Die Ausrichtung der Fiskalpolitik ist sehr restriktiv. Das gesamte Konsolidierungsvolumen beträgt 2025 ca. 1,6 % des BIP (hellblaue Balken). Etwa die Hälfte davon (ca. 4 Mrd EUR bzw. 0,8 % des BIP) sind Konsolidierungsmaßnahmen der neuen Regierung (siehe Tabelle K1). Die größten davon sind die Abschaffung des Klimabonus und Erhöhungen diverser indirekter Steuern. Unsere Einschätzungen des Sparvolumens liegen vor allem bei den Kürzungen von Sachausgaben und Transfers unter den offiziellen Angaben der Regierung. Ohne das Paket der neuen Regierung würde der Budgetsaldo 2025 bei etwa –4,5 % des BIP liegen. Da die Kürzungen bei öffentlichen Konsum- und Investitionsausgaben klein sind, dämpft das Paket das BIP-Wachstum nur geringfügig.
Außerdem liefen zu Jahresbeginn einige expansive Budgetmaßnahmen der vorangegangenen Regierung aus. Dies betrifft unter anderem die Strompreisbremse, die Senkung der Energieabgaben sowie die Aussetzung der Ökostromabgaben.
Grafik K1
Tabelle K1
| OeNB-Einschätzung | ||
| 2025 | 2026 | |
|
Vergleich zur OeNB-
Prognose vom Dez. 2024 |
||
| Gesamtes Volumen (in Mrd EUR) | 3,9 | 5,0 |
| Streichung Klimabonus | 2,1 | 2,1 |
| Sonstige Konsolidierung | 2,4 | 4,5 |
| Offensivmaßnahmen | –0,6 | –1,6 |
| Gesamtes Volumen (in % des BIP) | 0,8 | 1,0 |
| Effekt auf Budgetsaldo 1 (in PP) | 0,7 | 0,8 |
| Effekte auf BIP-Wachstum (in PP) | –0,2 | –0,1 |
| Quelle: Bundesregierung, OeNB. | ||
| 1 Nach Multiplikator-Effekten. | ||
| Anmerkung: PP = Prozentpunkte. | ||
Die Budgetkonsolidierung wird 2025 aber durch mehrere Faktoren behindert: Die fortgesetzt schwache Wirtschaftsentwicklung dämpft das Wachstum der Steuereinnahmen und erhöht die Ausgaben im Arbeitsmarktbudget (grüne Balken). Sonstige Einflussfaktoren wirken 2025 negativ auf den Budgetsaldo (dunkelblaue Balken): Wir gehen von rückläufigen Einnahmen aus dem EU-Budget und aus Dividenden sowie von steigenden Zinsausgaben aus. Zudem wurde die budgetäre Entwicklung in den letzten Jahren sehr stark durch „Revenue Windfalls“ gestützt. So wird in Fachkreisen das Phänomen bezeichnet, wenn die Steuereinnahmen stärker steigen als es die BIP-Entwicklung und die steuerlichen Maßnahmen erwarten lassen. Obwohl es in diesem Zeitraum praktisch nur Steuersenkungen gab, ist die Abgabenquote von 2017 auf 2024 von ca. 43 % auf ca. 45 % gestiegen. Letzterer Wert liegt nur geringfügig unter den historischen Höchstwerten des Zeitraums um die Jahrtausendwende.
Wenn sich die Abgabenquote seit 2017 nur aufgrund steuerlicher Änderungen bewegt hätte, wäre sie 2024 aber unter 41 % des BIP gelegen. Hauptgrund für die höhere Abgabenquote war der starke Anstieg der Lohnquote. Löhne werden grundsätzlich höher besteuert als Unternehmensgewinne; somit steigt durch einen höheren Anteil der Lohneinkommen am BIP auch automatisch der Anteil der Abgaben am BIP. Zudem stiegen die Steuereinnahmen aus Einkommenskomponenten, die nicht Teil des BIP sind. Dies betrifft vor allem Bewertungsgewinne, Gewinnausschüttungen und Pensionen. Diese Revenue Windfalls werden sich über den Prognosehorizont zu einem kleinen Teil umkehren. Zudem stellen sie ein signifikantes Risiko für den mittelfristigen budgetären Ausblick dar.
Zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen, die Mitte 2025 in Kraft getreten sind, werden 2026 voll wirken. Zusätzlich werden die Tarifstufen der Einkommensteuer nicht voll an die Inflation angepasst. Einige expansive Maßnahmen der Vorjahre werden zudem auslaufen. Insgesamt liegt damit das Konsolidierungsausmaß 2026 bei 0,8 % des BIP (hellblaue Balken). Gleichzeitig wird sich der konjunkturelle Beitrag zum Budget verbessern (grüne Balken). Dadurch verbessert sich der Budgetsaldo 2026 auf –3,3 % des BIP und 2027 auf –3,1 % des BIP.
5 Fiskalmaßnahmen und Zölle als wesentliche Risiken der Prognosen
In den ersten Monaten der Präsidentschaft Donald Trumps bricht die US-Politik mit traditionellen und bewährten Bündnissen und Beziehungen. Dies gilt sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Kontext. Die europäische Neubewertung der geopolitischen Situation führt zu einer Beschleunigung bei der Aufrüstung. Während die gesamteuropäischen Pläne politisch wie finanziell noch unsicher sind, wurden in Deutschland bereits weitreichende Entscheidungen getroffen. CSU/CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich auf ein Sondervermögen für Infrastruktur und Umweltmaßnahmen in der Höhe von 500 Mrd EUR (rund 14 % des deutschen BIP) geeinigt. Darüber hinaus sollen in Zukunft Verteidigungsausgaben über 1 % des BIP nicht von der Schuldenbremse erfasst werden. Diese Vorhaben stellen einen enormen fiskalpolitischen Impuls für Deutschland dar, der auch auf Österreich wirtschaftlich ausstrahlen wird. OeNB-Schätzungen zufolge könnten alleine die höheren deutschen Infrastrukturausgaben das BIP-Wachstum in Österreich 2026 um 0,1 bis 0,3 Prozentpunkte erhöhen. Vertrauenseffekte können aber bereits 2025 einen zusätzlichen positiven Konjunkturimpuls liefern. Weitere Effekte ergeben sich durch die höheren Verteidigungsausgaben Deutschlands. Die Höhe dieser Effekte ist schwer abschätzbar, da noch keine genaueren Informationen zur Verwendung, zur Höhe und zur zeitlichen Abfolge vorliegen. 5 Der angekündigte massive Fiskalimpuls führte bereits zu einem Anstieg der Rendite auf längerfristige Bundesanleihen (Anstieg um 40 Basispunkte) in Deutschland, aber auch in Österreich. Dadurch verteuern sich sowohl die staatliche als auch die private Refinanzierung.
Wirtschaftlich dominierte in den letzten Wochen die erratische Handelspolitik des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump die Schlagzeilen. Bisher lagen die eingeführten Zölle zwar unter den zuvor angedrohten, oder wurden kurz nach ihrer Einführung wieder zeitlich befristet ausgesetzt. Dennoch lässt diese Politik die handelspolitische Unsicherheit auf neue Höchststände steigen. Die Einführung von Gegenzöllen der Handelspartner könnte eine Zollspirale in Gang setzen und in einem Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt münden. Eine Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Politik wird durch die hohe Unsicherheit erschwert. Ein allgemeiner Zollsatz der USA auf alle EU-Produkte von 25 % würde nach OeNB-Berechnungen zu einem BIP-Rückgang 2025/26 von rund einem dreiviertel Prozentpunkt führen. Negative Vertrauenseffekte könnten den Rückgang noch verstärken. Die US-Zölle werden sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung der USA niederschlagen. Die Echtzeitprognosen der Federal Reserve Bank of Atlanta von Anfang März 2025 deuten auf einen Rückgang der US-Wirtschaftsleistung im ersten Quartal hin. Die zuletzt schwächeren Aussichten für die US-Wirtschaft, die jüngste Euro-Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und der niedrigere Rohölpreis konnten nicht mehr in den externen Annahmen dieser Prognose berücksichtigt werden und stellen daher Abwärtsrisiken dar.
Das größte heimische Abwärtsrisiko stellt ein zusätzlicher Budgetkonsolidierungsbedarf dar.
6 Auslaufen staatlicher Maßnahmen stoppt Inflationsrückgang vorübergehend – Inflationsrate liegt 2025 weiterhin bei 2,9 %
Laut der aktuellen Inflationsprognose der OeNB wird die HVPI-Inflationsrate 2025 2,9 % betragen – wie auch schon 2024. Das liegt daran, dass sich die weiterhin hohe Dienstleistungsinflation nur langsam zurückbildet, und die Energieinflation deutlich steigt. Zu einem Anstieg der Energieinflation kommt es, weil das Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen einige Preise für Haushalts-Energie im Jänner 2025 stark erhöhte. Besonders der Preis für Strom ist im Jänner durch das Auslaufen der Strompreisbremse mit einem Plus von 45 % stark gestiegen.
Erst 2026 sinken Energie- und Dienstleistungsinflation merklich, sodass die HVPI-Inflation 2026 etwa 2,3 % beträgt. 2027 nähert sie sich mit 2,1 % wieder dem Zielwert des Eurosystems von 2 % an.
Die OeNB-Analyse und -Prognose bezieht sich immer auf die HVPI-Inflationsrate. Sie wird in allen EU-Ländern gleich berechnet und von den Zentralbanken des Eurosystems zur Bewertung der Preisstabilität verwendet.
Die Kerninflation (HVPI-Inflation ohne Energie- und Nahrungsmittelinflation) ist 2025 mit 2,9 % gleich hoch wie die HVPI-Inflation. 2026 und 2027 sinkt sie aufgrund der geringeren Dienstleistungsinflation: im Jahr 2027 auf 2,3 %. Die Kerninflation sinkt 2026 wesentlich lang-samer als die HVPI-Inflation. Der Grund dafür ist die geringere Energieinflation. Diese dämpft die HVPI-Inflation, hat aber keine Auswirkungen auf die Kerninflation.
Am Ende des Prognosehorizonts, im letzten Quartal 2027, nähern sich sowohl die HVPI-Inflation als auch die Kerninflation ihren langfristigen Durchschnittswerten an (von 2011 bis 2019: 1,9 % Inflation bzw. 2,0 % Kerninflation).
Tabelle 2
| Prognose |
Revisionen gegenüber
Dezember 2024 |
||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Veränderung zum Vorjahr in % | in Prozentpunkten | ||||||||
| HVPI-Inflation | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | |
| Nahrungsmittel insgesamt | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| davon unverarbeitete Nahrungsmittel | 0,6 | 2,0 | x | x | –0,2 | 0,1 | x | x | |
| davon verarbeitete Nahrungsmittel | 3,4 | 2,6 | x | x | 0,0 | 0,3 | x | x | |
| Industriegüter ohne Energie | 0,9 | 1,1 | x | x | –0,1 | 0,3 | x | x | |
| Energie | –5,4 | 3,7 | –0,7 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 0,8 | –2,3 | |
| Dienstleistungen | 5,7 | 3,9 | x | x | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| HVPI ohne Energie | 3,7 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | |
| HVPI ohne Energie und Nahrungsmittel | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | |
|
Quelle: OeNB, Statistik
Austria.
Anmerkung: Der gesamte Inflationsbeitrag des öffentlichen Sektors wurde auf der Basis gerundeter Teilbeiträge ermittelt. |
|||||||||
Der Bericht analysiert in weiterer Folge zunächst die Inflationsentwicklung 2024, bevor er auf Details der Inflationsprognose 2025–2027 eingeht. Danach wird die prognostizierte Inflations-entwicklung Österreichs 2025–2027 mit jener des Euroraums verglichen.
6.1 Rückblick Inflationsentwicklung 2024: Starker Rückgang der Inflation in den letzten Monaten des Jahres
2024 war ein deutlicher Inflationsrückgang zu beobachten: Die Inflationsrate halbierte sich –von 7,7 % 2023 auf 2,9 % 2024. Dieser deutliche Rückgang geht auf alle vier Sub-Aggregate der HVPI-Inflationsrate zurück: Energie, Nahrungsmittel, Industriegüter ohne Energie, und Dienstleistungen. Einen besonders großen Beitrag zum Rückgang der Inflationsrate lieferten die sinkenden Energiepreise in der zweiten Jahreshälfte.
Sie reduzierten die HVPI-Inflationsrate deutlich (braune Balken in Grafik 6). Auch die Inflation der übrigen Aggregate wurde 2024 geringer: Nahrungsmittel (grün) und Industriegüter ohne Energie (dunkelblau) trugen in der zweiten Jahreshälfte kaum noch zur HVPI-Inflation bei. Diese war fast ausschließlich das Resultat der Dienstleistungsinflation. Zwar sank diese im Jahresverlauf (Jänner 2024: 6,8 %), lag aber im Dezember mit 5,1 % noch immer über ihrem langjährigen Mittelwert von 2,4 % (2001–2019) und damit deutlich über der HVPI-Inflationsrate. Die stark gestiegenen Lohnkosten beeinflussen die Preise für Dienstleistungen stärker als die Preise der anderen drei Aggregate.
Grafik 6
Die Energieinflation lag 2024 bei –5,4 %. Die Inflationsraten der meisten Energiearten (Kfz-Kraftstoffe, flüssige und feste Brennstoffe, Gas und Fernwärme) ausgenommen Strom waren negativ. Die Energieinflation sank vor allem bei Gas, festen Brennstoffen und Fernwärme um mehr als 10 Prozentpunkte. Im letzten Quartal 2024 lag die Gasinflation sogar bei –27 %. Dies liegt vor allem daran, dass die Energieanbieter die Preise bestehender Verträge über die vertragliche Indexierung gesenkt haben. Allerdings war der Gaspreis für Verbraucher:innen im Dezember 2024 noch immer etwa doppelt so hoch wie zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022. Im Durchschnitt des Euroraums liegt der Gaspreis schon länger nur mehr beim 1,6-Fachen des Preises von 2021.
Unter anderem führt der schwache Wettbewerb zu den weiterhin hohen Energiepreisen, weil österreichische Verbraucher:innen selten den Energieanbieter wechseln. So hat mehr als die Hälfte der Verbraucher:innen noch niemals den Gas- oder Stromanbieter gewechselt. Mehr als zwei Drittel der Verbraucher:innen kennen auch ihren persönlichen Gas- oder Strompreis nicht. 6
Die Entwicklung des Strompreises 2024 hängt vor allem mit zwei staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zusammen: der Strompreisbremse und dem Netzkostenzuschuss. Die Strompreisbremse, die im Dezember 2022 eingeführt wurde, übernahm einen Teil der Stromkosten bis zu einem Verbrauch von 2.900 kWh/Jahr.
Dabei wurde der Teil des Arbeitspreises subventioniert, der über 10 Cent/kWh lag. Allerdings betrug die Subvention maximal 30 Cent/kWh (ab Juli 2024 maximal 15 Cent/kWh). Dadurch profitierten Verbraucher:innen von günstigen und weitgehend stabilen Strompreisen, ohne zu billigeren Anbietern wechseln zu müssen. Deshalb veränderte sich der – zur Inflationsberechnung verwendete – Strompreisindex im Jahresverlauf wenig. Nur das Auslaufen des Netzkostenzuschusses Ende 2023 führte zu einer Preiserhöhung zu Beginn des Jahres 2024. Insgesamt trugen diese beiden Maßnahmen – trotz sinkender Großhandelspreise – 2024 zu einer leicht positiven Inflationsrate bei Strom bei.
Die Nahrungsmittelinflation (inkl. Alkohol und Tabak) betrug 2024 nur noch 2,9 %. Nach einem starken Rückgang im ersten Halbjahr schwankt sie danach zwischen 1,5 % und 3 %.
Besonders deutlich war der Rückgang der Inflationsrate bei verarbeiteten Lebensmitteln (z. B. Getränke, Tiefkühlkost), die sich im Laufe des Jahres auf 2,2 % im Dezember 2024 drittelte. Dies ist auf geringere Wareneinsatz- und Energiekosten zurückzuführen. Besonders die Inflationsraten bei Getränken (Bier, Wein, Mineralwässer, Säfte) sanken deutlich.
Die Inflationsrate bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln (z. B. Obst, Gemüse, Frischfleisch) war im Jahresverlauf sogar mehrfach negativ – d. h. die Preise waren in einigen Monaten geringer als in den Vorjahresmonaten. Obst etwa war in den Sommermonaten billiger als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Deshalb betrug die Jahresinflationsrate nur 0,6 % – ein Wert, der deutlich unter der HVPI-Inflationsrate liegt.
Die bereits zu Jahresanfang 2024 geringe Inflationsrate von Industriegütern ohne Energie ging im Jahresverlauf nochmals deutlich zurück. Sie betrug im Jahresdurchschnitt 2024 nur noch 0,9 % (2023: 6,4 %). In der zweiten Jahreshälfte lag die Inflationsrate bei maximal 0,5 % und damit deutlich unter ihrer langfristigen Inflationsrate von 0,9 % (2001–2019). Ursachen hierfür sind erstens, dass die Großhandels- und Erzeugerpreise weitgehend stagnierten und daher kein Kostendruck entstand. Zweitens machte es die weiterhin geringe Konsumnachfrage nach Gütern sehr schwer, Preise zu erhöhen. Besonders deutlich war der reale Umsatzrückgang im Bücher- und Zeitschriftenhandel, sowie im Möbelhandel. Letzterer leidet noch immer daran, dass ein Großteil des Möbelbedarfs während der COVID-19-Pandemie abgedeckt wurde.
Der Rückgang der Inflationsraten war nahezu flächendeckend zu beobachten. Besonders deutlich fiel er bei Möbeln und Einrichtungsgegenständen, bei Telefonen und Kommunikationsgeräten sowie bei Bekleidung und Schuhen aus. Diese Kategorien weisen seit Mai 2024 negative Inflationsraten – also Preisrückgänge im Vorjahresvergleich – auf.
Die Dienstleistungsinflation lag 2024 bei durchschnittlich 5,7 %. Im Jahresverlauf ging sie kontinuierlich zurück und lag im vierten Quartal 2024 bei etwa 5 %. Das ist allerdings noch immer deutlich über den Inflationsraten der anderen HVPI-Aggregate und über ihrem langfristigen Durchschnitt von 2,4 % (2001–2019). Haupttreiber der hohen Dienstleistungsinflation waren vor allem Gast- und Beherbergungsdienstleistungen, Freizeit- und Sportdienstleistungen (etwa Lift-Tickets) sowie Mieten.
Die Nachfrage im Tourismus war 2024 sehr hoch. Mit 154 Millionen Nächtigungen wurde 2024 ein neuer Tourismus-Rekordwert verzeichnet 7 . Diese starke Nachfrage konnten die Unternehmen nutzen, um ihre Preise zu erhöhen. Dadurch konnten sie die gestiegenen (Lohn-)Kosten weiterreichen. Die Lohnsteigerung im Tourismus lag mit 8,6 % zwar im österreichischen Durchschnitt. Im personalintensiven Tourismus führen diese hohen Lohnsteigerungen aber zu einem stärkeren Anstieg der Gesamtkosten.
Auch Reparaturen und Leistungen im Bereich Wohnen sowie Finanzdienstleistungen und Versicherungen hatten Inflationsraten von deutlich über 5 %. Wegen ihres geringen Gewichts ist ihr Einfluss auf die Dienstleistungs- und damit auch die HVPI-Inflation allerdings geringer.
6.2 Inflationsprognose 2025–2027: Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen verzögert Inflationsrückgang
Für 2025 erwartet die OeNB nunmehr eine Inflationsrate von 2,9 % – genauso hoch wie 2024. Dies bedeutet eine Aufwärtsrevision von etwa einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur OeNB-Prognose vom Dezember 2024. Diese Revision war aufgrund höherer Inflationsraten zu Jahresbeginn und ganz besonders wegen des unerwartet hohen Anstieges der Energieinflation im Jänner 2025 nötig. Das Auslaufen staatlicher Unterstützungsmaßnahmen (wie z. B. der Strompreisbremse) hat die Energiepreise stärker als erwartet ansteigen lassen. Insgesamt erhöhten staatliche Maßnahmen die HVPI-Inflation im Jänner 2025 um etwa 1,1 Prozentpunkte. 8
2026 sinken Energie- und Dienstleistungsinflation und damit die HVPI-Inflationsrate. Sie wird 2026 2,3 % betragen und 2027 auf 2,1 % zurückgehen. Damit nähert sie sich wieder dem Preisstabilitätsziel des Eurosystems von 2 % an.
Die Kerninflation (HVPI-Inflation ohne die volatilen Aggregate Energie und Nahrungsmittel) sinkt 2025 auf 2,9 % nach 3,9 % 2024. Der weitere Rückgang der Kerninflation erfolgt langsamer als jener der HVPI-Inflation. Bei der Berechnung der Kerninflation spielt der erwartete starke Rückgang der Energieinflation keine Rolle. Hingegen bildet sich die Dienstleistungsinflation langsamer zurück, sodass die Kerninflation 2027 mit 2,3 % über der Gesamtinflation liegen wird.
Staatliche Maßnahmen beeinflussen vor allem die Energieinflation . Anfang 2025 sind eine Reihe fiskalpolitischer Maßnahmen ausgelaufen, die die Energiepreise reduziert hatten: Die Strompreisbremse lief aus, die Elektrizitäts- und Erdgasabgabe wurde wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht und die Erneuerbarenpauschale und der Erneuerbarenförderbeitrag wurde wieder eingehoben. Zusätzlich wurden die Netzentgelte im Strom- und Gasnetz und der Preis für den Ausstoß von CO2 (von 45 auf 55 EUR/kWh) erhöht. Die staatlichen Maßnahmen waren der Grund für den deutlichen Anstieg der Energieinflation von –7,8 % im Dezember 2024 auf 5,2 % im Jänner 2025. Besonders spürbar sind die Maßnahmen bei Strom, dessen Preis im Jänner 2025 im Vergleich zu Dezember 2024 um 45 % stieg. Auch der Gaspreis stieg im Jänner aufgrund der fiskalischen Maßnahmen, allerdings nur um etwa 10 %.
Die OeNB prognostiziert eine Energieinflation von 3,7 % für 2025. Dabei ist folgende Annahme maßgeblich: Der Preis von Haushaltsenergie sinkt im Jahresverlauf deutlich. Die OeNB geht davon aus, dass der Preisanstieg bei Strom und Gas zu Jahresbeginn deutlich mehr Haushalte motiviert, aktiv zu günstigeren Anbietern zu wechseln als früher.
Die im Jahresverlauf 2025 sinkenden Preise von Haushaltsenergie und der weitere Rückgang der Großhandelspreise für Strom und Gas führen 2026 zu einer negativen Energieinflation. Diese ist vor allem in der ersten Jahreshälfte 2026 sehr ausgeprägt, weil die Energiepreise Anfang 2025 noch sehr hoch sind (Basiseffekt). 2027 stabilisieren sich die Preise im Vergleich zu den Vorjahresquartalen weitgehend – die Energieinflation 2027 liegt bei etwa 0 %.
Die Nahrungsmittelinflation sinkt 2025 auf 2,5 %. Dies ist auf den Rückgang der Inflation bei verarbeiteten Lebensmitteln von 3,4 % 2024 auf 2,5 % 2025 zurückzuführen. Verarbeitete Nahrungsmittel profitieren besonders von den etwas geringeren Preissteigerungen bei Löhnen. Die seit Ende 2024 deutlich gestiegenen Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und EU-Erzeugerpreise für Nahrungsmittel haben hingegen wegen ihres geringen Kostenanteils kaum einen Einfluss auf Preise der verarbeiteten Nahrungsmittel. Zum Beispiel betragen in Österreich die Rohstoffkosten bei einem Kilogramm Brot nur etwa 4 %. 9 Allerdings treiben die hohen Erzeugerpreise in der Landwirtschaft die Inflation unverarbeiteter Nahrungsmittel (z. B. Obst und Gemüse) im Vorjahresvergleich in die Höhe. Mit Nachlassen des Preisdrucks bei Energie, Löhnen und Erzeugerpreisen bei Nahrungsmitteln sinkt 2027 auch die Inflationsrate bei Nahrungsmitteln auf 2,2 %.
Die Inflationsrate bei Industriegütern ohne Energie (z. B. Möbel, Autos, Bekleidung) bleibt 2025 weitgehend konstant bei 1,1 %. Stabile Erzeugerpreise sowie eine weiterhin schwache erwartete Nachfrage lassen auf geringe Preisanstiege im Prognosehorizont schließen.
Die Dienstleistungsinflation sinkt 2025 um beinahe 2 Prozentpunkte auf 3,9 %, bleibt aber der wichtigste Inflationstreiber (vgl. Grafik 6). Im Dienstleistungssektor besteht ein größerer Teil der Kosten aus Löhnen als in anderen HVPI-Aggregaten. Die Lohnsteigerung, gemessen am Tariflohnwachstum, ist 2025 mit 3,6 % prognostiziert. Da es keinen Hinweis auf einen deutlichen Rückgang der Nachfrage gibt, wird eine Weitergabe der Kosten an die Konsument:innen angenommen. Im Einklang mit den langsam sinkenden Lohnsteigerungen sinkt die Dienstleistungsinflation deshalb nur langsam.
6.3 Aufwärtsrevision der Inflationsprognose im Vergleich zur OeNB-Prognose vom Dezember 2024
Im Vergleich zum Dezember 2024 hat die OeNB ihre aktuelle Prognose für die HVPI-Inflation für den gesamten Prognosehorizont 2025–2027 nach oben revidiert. Die Erhöhung fällt 2025 mit einem halben Prozentpunkt am deutlichsten aus, die Erhöhung in den übrigen Jahren ist moderat (Tabelle 2). Ausschlaggebend für die Revision sind die realisierten Inflationsraten in den ersten beiden Monaten 2025, die um etwa einen halben Prozentpunkt höher ausfielen als prognostiziert. Besonders die Energieinflation im Jänner 2025 wurde in der OeNB-Prognose vom Dezember 2024 deutlich unterschätzt. Das Auslaufen der Fiskalmaßnahmen beeinflusste die Inflationsrate im Jänner stärker als prognostiziert. Während die OeNB-Prognose von einem energiepreisbedingten Anstieg der HVPI-Inflation um 0,75 Prozentpunkte ausging, beziffert ihn Statistik Austria mit etwa 1,1 Prozentpunkten. Die HVPI-Inflationsrate stieg von 2,1 % im Dezember 2024 auf 3,4 % im Jänner 2025 (OeNB-Prognose vom Dezember 2024: Anstieg von 2,0 % auf 2,9 %). Da das Auslaufen der Fiskalmaßnahmen die Energiepreise dauerhaft erhöht, ergibt sich eine höhere Inflationsrate für 2025. Höhere Großhandelspreise für Gas, Strom und Erdöl führen zu einer geringfügig höheren Energieinflation 2026. Die Abwärtsrevision 2027 ist hingegen ein technisches Artefakt. Höhere Welthandelspreise für Nahrungsmittel bedingen eine höhere Nahrungsmittelinflation.
Die höhere Dienstleistungsinflation 2025 ergibt sich aus den höheren Lohnsteigerungen sowie der unerwartet persistenten Dienstleistungsinflation zu Jahresbeginn. Auch die Inflation von Industriegütern ohne Energie wurde aufgrund der zuletzt beobachteten Daten 2025 erhöht.
6.4 Risiken der Inflationsprognose
Die Inflationsprognose ist mit Aufwärtsrisiken behaftet, das heißt die Inflationsrate könnte höher ausfallen als prognostiziert. Erstens könnten geopolitische Spannungen zu einem höheren Preisdruck führen: Insbesondere können die angekündigten US-Zölle und Vergeltungszölle der US-Handelspartner zu höherer Inflation führen. Zweitens würde eine stärkere und schnellere Erholung der Inlandsnachfrage die Inflation anheizen, vor allem wenn die Konsumnachfrage stärker ansteigt als prognostiziert. Drittens wurde in dieser Prognose angenommen, dass der Preis von Strom im Jahresverlauf um etwa 20 % sinkt, jener von Gas um etwa 10 %. Dazu müssten Energiekund:innen aktiv zu billigeren Vertragspartnern wechseln. Dies würde eine Verhaltensänderung bedeuten, weil die bisherige Wechselwilligkeit gering war. Bei gleichbleibenden Energiepreisen wäre die Inflation etwa einen viertel Prozentpunkt höher. Die Bedeutung der Risiken, die aus der Fiskalpolitik kommen, können noch schwer abgeschätzt werden.
Ein europäischer Fiskalimpuls (Stichwort: höhere europäische Verteidigungsausgaben) könnte auch die österreichische Inflation anheizen. Aus Österreich selbst ist durch die Konsolidierungspakete ein inflationsdämpfender Fiskalimpuls zu erwarten.
6.5 Inflationsdifferenz zwischen Österreich und dem Euroraum
Gemäß den Prognosen des Eurosystems wird 2025 die Inflationsdifferenz 0,6 Prozentpunkte betragen – wie bereits 2024. Das heißt, Österreichs Inflation wird 2025 im Durchschnitt um 0,6 Prozentpunkte über jener des Euroraum-Durchschnitts liegen. Danach gleichen sich die Inflationsraten zwischen Österreich und dem Euroraum-Durchschnitt schrittweise an, bis sie 2027 annähernd gleich sind (Grafik 7).
Grafik 7
Ende 2024 lag Österreichs Inflationsrate sogar unter jener des Euroraums. Dies war vor allem auf das Sinken der Energiepreise in Österreich zurückzuführen. 2025 führt die Energiepreisentwicklung jedoch wieder zu einem Anstieg der Inflationsdifferenz.
Das Auslaufen der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Strompreisbremse) ließ die Energieinflation in Österreich im Jänner 2025 wieder stark ansteigen. In den meisten anderen Euroraum-Ländern liefen die preissenkenden Unterstützungsmaßnahmen bereits Anfang bzw. Mitte 2024 aus. Daher kam es im Euroraum-Durchschnitt zu Jahresbeginn 2025zu keinem außergewöhnlichen Anstieg der Energieinflation.
Der Inflationsabstand bei den Dienstleistungen hat sich bereits im Jahresverlauf 2024 verringert. Allerdings bleibt die Dienstleistungsinflation über den gesamten Prognosehorizont über jener des Euroraums. Eine deutlich höhere Dienstleistungsinflation in Österreich als im Euroraum ist seit 2011 die Norm. Seit damals ist die Dienstleistungsinflation um durchschnittlich 0,7 Prozentpunkte höher als im Euroraum-Durchschnitt. Dies reflektiert auch die in Österreich seit dieser Zeit stärker steigenden Lohnstückkosten.
Die europaweite Einführung einer CO2-Bepreisung auf Treibstoffe und Haushaltsenergie (ETS2 10 ) wird dazu führen, dass die Energiepreise Anfang 2027 ansteigen. Österreich führte die CO2-Bepreisung bereits 2022 ein. Der für 2027 vorgesehene EU-weite Mindestpreis ist nur geringfügig höher als der derzeitige CO2-Preis in Österreich. Deshalb bleibt die Energieinflation 2027 in Österreich niedrig. In Staaten, die noch keine CO2-Bepreisung eingeführt haben, wird sich die Energieinflation deutlich erhöhen. Deshalb wird Österreichs Energieinflation unter jener des Euroraum-Durchschnitts bleiben und die Inflationsdifferenz senken.
-
Oesterreichische Nationalbank, Referat Konjunktur, konjunktur@oenb.at . Unter Mitarbeit von Birgit Niessner. ↩︎
-
Details zur Methode des OeNB-Konjunkturindikators siehe OeNB-Konjunkturindikator - Oesterreichische Nationalbank (OeNB) . ↩︎
-
Aus der aktuellen Importstruktur lassen sich somit keine Schlüsse auf die zukünftigen (Waffen-)Importe schließen. Aktuell liegt der Anteil österreichischer Militärexporte an den gesamten Militärimporten Deutschlands zwar bei knapp 3 %.
Absolut betrachtet entspricht dies aber nur 5–10 Mio EUR pro Jahr. ↩︎ -
Bundeswettbewerbsbehörde/E-Control. 2024. Unsere Energie fokussiert auf mehr Transparenz . ↩︎
-
Statistik Austria (2025), Pressemitteilung 13 526-020/25 . ↩︎
-
Statistik Austria (2025), Pressekonferenz „Inflation 2024“ vom 15. Jänner 2025. PowerPoint-Präsentation . Der Effekt wird für Dezember 2024 berechnet, ist aber auch für Jänner 2025 in ähnlicher Größenordnung gültig. ↩︎
-
Landwirtschaftskammer Steiermark 2023. Lebensmittelpreise durchleuchten! | Landwirtschaftskammer Steiermark . ↩︎
-
ETS = Emissions Trading Scheme. Siehe: ETS2: buildings, road transport and additional sectors - European Commission . ↩︎