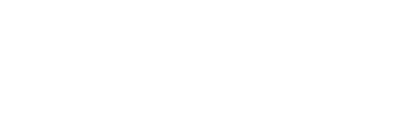Geschäftsbericht 2024
Vorwort des Präsidenten
Liebe Leser:innen,
die österreichische Wirtschaft befindet sich seit 2023 in einer hartnäckigen Rezession. Unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen bleibt es herausfordernd, rasch auf einen langfristigen Wachstumspfad zurückzukehren. Auch die Wirtschaft in Deutschland, unserem wichtigsten Handelspartner, stagniert. Im Hinblick auf das multilaterale Handelssystem könnten angekündigte handelspolitische Maßnahmen der USA zu einer weiteren Fragmentierung des globalen Handels führen. Unsicherheiten bestimmen damit den Ausblick für 2025 und stellen die europäische Wirtschaftspolitik vor große Herausforderungen.
Die OeNB verzeichnet nach 2023 auch 2024 — zum zweiten Mal in ihrer Geschichte — ein negatives Geschäftsergebnis. Zudem wird 2024 erstmals ein negatives Eigenkapital ausgewiesen. Die OeNB kann auch mit einem negativen Eigenkapital all ihre Aufgaben im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken weiter erfüllen. Der aus der Geldpolitik resultierende Bilanzverlust führt zu einem Abschmelzen der Risikodeckungsmassen. Vor diesem Hintergrund hatte sich das Direktorium für das Jahr 2024 für eine Reduktion des Risikos und eine Adaptierung des Veranlagungsvolumens im Reservemanagement entschieden. Im Jahr 2024 verzeichneten die Finanzmärkte eine zufriedenstellende Wertentwicklung, was sich auch positiv auf das Veranlagungsergebnis der OeNB auswirkte.
Der Einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) feierte im November 2024 sein zehnjähriges Bestehen. Der SSM fördert die Stabilität und Resilienz der österreichischen und europäischen Bankenlandschaft. Die österreichischen Banken befinden sich in einer guten Ausgangslage, um mit den gestiegenen ökonomischen und geopolitischen Herausforderungen umzugehen. Auch das Finanzmarktstabilitätsgremium hat in seiner zehnjährigen Tätigkeit wichtige Maßnahmen ergriffen und so das Risiko von Finanzkrisen verringert und die Finanzmarktstabilität in Österreich gestärkt.
In Österreich bleibt Bargeld wichtig und für viele Menschen unverzichtbar, selbst in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Mit Blick auf eine flächendeckende Bargeldversorgung vereinbarten der Österreichische Gemeindebund und die österreichischen Banken, die Bargeldversorgung im ländlichen Raum vorerst bis 2029 abzusichern.
Die OeNB bekräftigte mit ihren aktuellen Förderungsvergaben ihr langjähriges Engagement für die wirtschaftsorientierte Forschung. Mit ihrem Förderprogramm unterstützt die OeNB unabhängige und wissenschaftsbasierte Wirtschaftsforschung als öffentliches Gut sowie das dahinter liegende öffentliche Interesse. Insgesamt wurden für den Zeitraum 2025—2027 fünf Wirtschaftsforschungsinstituten Basisfinanzierungen zuerkannt. Darüber hinaus genehmigte die OeNB im Berichtsjahr 26 Forschungsprojekte mit thematischem Notenbankbezug aus den Mitteln ihres Jubiläumsfonds.
Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Direktoriums und den Mitarbeiter:innen der OeNB-Unternehmensgruppe für ihre hervorragenden Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie bei den Mitgliedern des Generalrats für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Wien, im März 2025
Harald Mahrer, Präsident
Vorwort des Gouverneurs
Liebe Leser:innen,
auch 2024 war von zahlreichen geopolitischen Konflikten und Kriegen geprägt, die zu großen politischen und ökonomischen Herausforderungen führten. Darüber hinaus wurden in mehreren wesentlichen Volkswirtschaften Wahlen abgehalten, deren Ergebnisse politisch und wirtschaftlich von Bedeutung sind.
Die Wirtschaftstätigkeit im Euroraum nahm 2024 wieder etwas zu und das Wirtschaftswachstum, gemessen am BIP, lag bei +0,7 %. Laut Prognose der EZB soll es 2025 auf +1,1 % und 2026 auf +1,4 % ansteigen. Die Inflation ging 2023 deutlich zurück und setzte diesen Abwärtstrend 2024 fort: Für das Gesamtjahr 2024 betrug sie 2,4 %. Für 2025 wird eine Rate von 2,1 % und für 2026 von 1,9 % erwartet.
Österreichs Wirtschaft verzeichnete 2024 im zweiten Jahr in Folge eine Rezession, die auf mehrere
negativ wirkende Faktoren zurückzuführen ist. Das BIP schrumpfte daher im Berichtsjahr um 1,0 %. Danach wird wieder mit einer moderaten Erholung gerechnet: +0,8 % 2025 und +1,6 % 2026. Diese Prognose enthält jedoch aufgrund der notwendigen Budgetkonsolidierung ein Abwärtsrisiko. Die HVPI-Inflationsrate, die 2024 noch bei 2,9 % lag, dürfte 2025 auf 2,4 % und 2026 auf 2,2 % sinken.
Da sich die Inflation im Euroraum in Richtung des Zielwerts für Preisstabilität von 2 % bewegte, begann der EZB-Rat im Juni 2024 die Leitzinsen zu senken — bis Ende 2024 in vier Schritten um insgesamt 100 Basispunkte sowie im Jänner 2025 um weitere 25 Basispunkte. Darüber hinaus wurden die Bilanzen der Zentralbanken im Eurosystem weiter maßvoll abgebaut: Banken zahlten längerfristige Refinanzierungsgeschäfte zurück und die Wertpapiere aus den Ankaufprogrammen des Eurosystems begannen abzureifen.
Um den Euroraum vor einer wirtschaftlichen Depression und einer Deflation im Zuge der großen Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie zu bewahren, wurden unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen gesetzt. Diese führten im Zusammenspiel mit dem Anheben der Leitzinsen 2022 und 2023 auch im Jahr 2024 zu einem Verlust für das Eurosystem und für andere Zentralbanken weltweit. So bedeuten die höheren Zinssätze in der Einlagefazilität einen höheren Zinsaufwand für die Einlagen der Banken auf der Passivseite der Notenbankbilanz. Umgekehrt bringen auf der Aktivseite die umfangreichen Bestände an Anleihen, die die Zentralbanken zu niedrigen oder sogar negativen Renditen erwarben, nur einen sehr geringen Zinsertrag.
Auch die OeNB verzeichnete 2024 einen Bilanzverlust von 4,2 Mrd EUR und weist nunmehr ein negatives Eigenkapital aus. Der Verlust wird durch künftige Erträge abgebaut. Die Wirksamkeit der Geldpolitik bleibt davon jedoch unberührt. Gewinne und Verluste des Eurosystems, der OeNB und der EZB sind ein nachrangiges Ergebnis ihres gemeinsamen Mandats, die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Den vorübergehenden Verlusten müssen jedoch nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile der bisherigen expansiven Geldpolitik — v. a. die Stabilisierung der Wirtschaft im Euroraum — gegenübergestellt werden, sondern auch die budgetären Gewinne des Staates. So hat sich Österreich durch die unkonventionelle Geldpolitik und die niedrigeren oder gar negativen Zinsen seit 2012 rund 51 Mrd EUR an Zinsausgaben erspart.
An dieser Stelle herzlichen Dank dem Präsidium, dem Generalrat, den Direktoriumsmitgliedern sowie allen Mitarbeiter:innen für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und den außerordentlichen Einsatz. Dadurch werden wir auch weiterhin unsere Kernaufgaben zuverlässig erfüllen können.
Wien, im März 2025
Robert Holzmann, Gouverneur
Die OeNB im Profil und Kennzahlen zu Österreichs Banken
Wirtschaftsindikatoren für Österreich und Kennzahlen zum österreichischen Zahlungsverkehr
Aufgaben und Strategie der OeNB
„Sicherheit durch Stabilität. Der Euro — unsere Währung.“ Das ist die Vision der OeNB aus unserem Leitbild. Als unabhängige Zentralbank der Republik Österreich sind wir Teil des Eurosystems und wirken in internationalen Organisationen mit. Außerdem kommunizieren wir umfassend mit der Öffentlichkeit zu unseren Kernaufgaben:
Um diese Aufgaben umzusetzen und die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, haben wir uns bis 2025 sechs strategische Schwerpunkte als Ziele gesetzt. 2024 waren die Themen „digitaler Euro und Bargeld“, „künstliche Intelligenz“ sowie „Nachhaltigkeit“ spezielle Schwerpunkte, die wir auch weiterhin vorantreiben.
OeNB im Eurosystem und IWF, Geldpolitik und Volkswirtschaft
- Die OeNB strebt als Universal-Zentralbank im Eurosystem nach der Themenführerschaft in ausgewählten Bereichen.
- Die OeNB ist das Kompetenzzentrum für Geldpolitik und -theorie. Ihre Forschung unterstützt die Positionierung der OeNB im EZB-Rat.
- Die OeNB ist das Kompetenzzentrum für Angelegenheiten des IWF in Österreich.
- Die OeNB ist das Kompetenzzentrum für die Analyse wirtschaftlicher und finanzmarktpolitischer Herausforderungen.
- Die OeNB ist die Denkfabrik in Österreich zum Thema Konjunktur — dabei beachtet sie besonders die Konsistenz von Mikro- und Makroökonomie.
- Die OeNB versorgt Österreich auch im digitalen Zeitalter mit Bargeld.
- Die OeNB engagiert sich im Rahmen des Eurosystems zum digitalen Euro und kommuniziert hierzu mit ihren Partnern in Österreich.
Finanzmarktstabilität und -strategie
- Die OeNB trägt zur Erhöhung der Transparenz durch hochwertige Finanzstatistiken bei und schafft damit Vertrauen.
- Die OeNB trägt dazu bei, die Stabilität des österreichischen Banken- und Finanzsystems zu sichern.
- Die OeNB setzt sich für eine effektive und proportionale, nach Möglichkeit vereinfachte und technologieneutrale Regulierung unter dem Dach der Bankenunion ein.
- Die OeNB trägt zur Stärkung des österreichischen Kapitalmarkts bei.
- Die OeNB wahrt das geldpolitische Mandat und die Stabilität des Banken- und Finanzsystems unter Berücksichtigung der Umsetzung der ESG-Kriterien.
Finanzinnovationen
- Die OeNB spielt als Innovatorin und Regulatorin eine zentrale Rolle bei Finanzinnovationen.
- Die OeNB übernimmt eine wesentliche Rolle, um den Finanzplatz Österreich gegen Cyberattacken widerstandsfähiger zu machen.
- Die OeNB kooperiert intensiv mit externen Partnern zur Stärkung von Finanzinnovationen.
Finanzbildung
- Die OeNB engagiert sich für die finanzielle Bildung und damit für die finanzielle Gesundheit der Bevölkerung in Österreich.
- Die OeNB strebt bei der Finanzbildungs-Kompetenz in Österreich eine internationale Top-Position an.
- Die OeNB strebt die Themenführerschaft bei der Messung der Finanzbildung und der Wirksamkeit von Maßnahmen an.
- Die OeNB positioniert sich als unabhängiges, attraktives und zugängliches Kompetenzzentrum für Finanzbildung in Österreich.
OeNB als Unternehmen; Personal und Digitalisierung
- Die OeNB versteht sich als modernes Unternehmen in Österreich.
- Die OeNB fördert ESG, also die nachhaltige und ethische Unternehmensführung.
- Die OeNB bekennt sich zu einem modernen Personalmanagement.
- Die OeNB forciert Digitalisierung und Automatisierung.
Kommunikation
- Die Mehrheit der Österreicher:innen kennt die OeNB.
- Die OeNB wird als unabhängig und modern wahrgenommen.
- Die OeNB wird als Themenführerin genannt bei den Themen Preisstabilität, Finanzmarktstabilität, Wirtschaftspolitik, Finanzstatistik, Finanzbildung, Geld und Zahlungsverkehr.
- Das Vertrauen der Bevölkerung und wichtiger Partner (insbesondere der Finanzwirtschaft) in die Institution und auch das Vertrauen der Mitarbeiter:innen in ihre Arbeitgeberin sind sehr hoch.
- Die Mitarbeiter:innen sind stolz, hier zu arbeiten.
- Die abteilungs- und ressortübergreifende interne Kommunikation funktioniert rasch und effektiv.
Inflation bewegt sich in Richtung Zielwert
Das Preisstabilitätsziel ist in greifbare Nähe gerückt
2023 ist die Inflation im Euroraum deutlich zurückgegangen. 2024 hat sie diesen Abwärtstrend fortgesetzt. Letztendlich sank sie von 10,6 % — ihrem Höchstwert im Oktober 2022 — auf 2,4 % im Dezember 2024. Die jüngste Prognose des Eurosystems (vom Dezember 2024) geht davon aus, dass die Inflation zu Jahresbeginn 2025 etwas über 2 % bleiben wird. Danach — also zwischen dem zweiten Quartal 2025 und dem Ende des Prognosezeitraums 2027 — soll sie um das Inflationsziel von 2 % schwanken.
Für den Rückgang der Verbraucherpreisinflation im Euroraum (gemessen am HVPI, dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex) gibt es mehrere Gründe: 2023 waren es v. a. sinkende Rohöl-, Gas- und folglich Großhandelsstrompreise, die für sinkende Inflationsraten sorgten. Zudem beruhigten sich die Preisanstiege bei Nahrungsmitteln. Einige Nahrungsmittel wie z. B. Brot sind in ihrer Herstellung energieintensiv. Diese Preise stiegen im Jahresverlauf 2023 und 2024 daher weniger stark. Zudem begannen die Leitzinsanhebungen zu wirken. Sie drosselten 2023 und 2024 die Nachfrage im Euroraum und in weiterer Folge die Preisanstiege v. a. bei Industriegütern. Preise von Industriegütern, wie z. B. Autos, reagieren traditionell stärker auf geldpolitische Signale als beispielsweise Dienstleistungspreise.
Inflationsschock klingt aus: Österreich nähert sich Euroraum-Durchschnitt
Österreichs HVPI-Inflation lag im Jänner 2024 mit 4,3 % noch um 1,6 Prozentpunkte über jener des Euroraums. Im Jahresverlauf sank sie in Österreich jedoch rascher und betrug im Dezember 2,1 % (verglichen mit 2,4 % im Euroraum). Dies ist bemerkenswert, da im langfristigen Durchschnitt die österreichische Inflation rund ½ Prozentpunkt über jener des Euroraums lag.
Der Rückgang fand in Österreich in allen wesentlichen Teilen des Warenkorbs statt. Die Energiepreise sanken im zweiten Halbjahr 2024 sogar. Anfang 2025 stieg die Inflation in Österreich erneut deutlich an. Das Auslaufen von Fiskalmaßnahmen (z. B. der Strompreisbremse), die die Inflation bisher gedämpft hatten, führte zu wieder steigenden Energiepreisen. Dementsprechend lag die österreichische Inflationsrate im Jänner 2025 wieder über jener des Euroraums.
Im Gesamtjahr 2024 sank die Inflation in Österreich auf 2,9 %, nach 7,7 % 2023 und 8,6 % 2022. 2025 ist trotz des vorübergehenden Anstiegs zu Jahresbeginn mit einem weiteren Rückgang auf 2,4 % zu rechnen. Bis 2027 wird ein Absinken auf 2 % erwartet (siehe Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich vom Dezember 2024 ; zur Zuverlässigkeit der OeNB-Inflationsprognose siehe OeNB-Blog vom 27. September 2024 ).
Die Kerninflation, d. h. die Gesamtinflation ohne Energie- und Nahrungsmittel, bleibt bis 2026 über der HVPI-Inflation, v. a. wegen der anhaltend hohen Dienstleistungsinflation. Diese wird weiterhin vom Beitrag der Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen bestimmt. 2027 sollen sowohl die HVPI- als auch die Kerninflation bei 2 % liegen und damit dem Preisstabilitätsziel der EZB für den Euroraum entsprechen.
EZB-Rat senkt Leitzinsen vorsichtig
Die Inflation im Euroraum bewegt sich in Richtung 2-%-Ziel. Für 2025 erwarten wir, dass das Preisstabilitätsziel erreicht wird. Daher begann der EZB-Rat im Juni 2024, schrittweise seine Leitzinsen zu senken. Als Mitglied dieses 26-köpfigen Gremiums war OeNB-Gouverneur Robert Holzmann direkt in diese Entscheidungen eingebunden. Insgesamt senkte der EZB-Rat die geldpolitischen Leitzinsen 2024 in vier Schritten um 100 Basispunkte sowie im Jänner 2025 um weitere 25 Basispunkte. Folglich sank der Zinssatz für die Einlagefazilität, an dem sich die kurzfristigen Geldmarktzinsen orientieren, von 4 % im Juni 2024 auf 2,75 % Anfang 2025. Die Geldpolitik wurde dadurch deutlich weniger restriktiv.
Die Zinsen wurden bisher langsamer gesenkt, als sie zuvor angehoben wurden. Für die Vorsicht des EZB-Rats gibt es mehrere Gründe:
Erstens besteht noch Unsicherheit, ob die letzten Meter bis zum 2-%-Ziel 2025 tatsächlich geschafft werden. Die Preise für Dienstleistungen, die ein großes Gewicht im HVPI-Warenkorb haben, zeigen (noch) keinen eindeutigen Abwärtstrend. Ihre Inflationsrate ist zwar 2024 im Vergleich zu 2023 geringer ausgefallen. Im Jahresverlauf 2024 schwankte sie allerdings beharrlich um 4 %.
Dafür ist v. a. die Entwicklung der Löhne verantwortlich. Löhne spiegeln sich in Dienstleistungspreisen stärker wider als in anderen Preisen: Naturgemäß ist bei Dienstleistungen Arbeit ein gewichtiger Kostenfaktor. In den letzten Jahren gab es einen starken Lohnanstieg im Euroraum (für die Entwicklung der Tariflöhne in Österreich siehe OeNB-Blog vom 12. August 2024 ). Die Arbeitnehmer:innen wollten die durch die hohe Inflation ausgelösten Reallohnverluste abgegolten haben. Dies ist bisher allerdings nur zum Teil erfolgt. Im dritten Quartal 2024 lagen die Reallöhne im Euroraum nach wie vor unter dem Niveau von Anfang 2021. Dementsprechend können Lohnforderungen, die die Inflation über 2 % halten, weiterhin nicht ausgeschlossen werden.
In seiner jüngsten Prognose (vom Dezember 2024 ) geht das Eurosystem zwar davon aus, dass das Lohnwachstum von 4,6 % (2024) auf 2,8 % (2027) zurückgehen wird. Im Vergleich zur Inflation sind Lohnzuwächse auch im Wirtschaftswachstum begründet und liegen im Durchschnitt über der Inflationsrate. Die Prognose basiert also auf der Annahme, dass in den Lohnverhandlungen der Druck von Arbeitnehmerseite geringer wird. Dementsprechend schwankt die Gesamtinflationsrate ab dem zweiten Quartal 2025 in den Prognosen um 2 %. Ob dies jedoch tatsächlich so eintreten wird, hängt vom Ausgang der Lohnverhandlungen ab. Auch dieser Umstand lässt den EZB-Rat bei Zinssenkungen vorsichtig agieren.
Zweitens können neue Preisschocks im Euroraum auftreten. So verdoppelten sich z. B. die Gaspreise von Februar bis Ende 2024. Auch die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle könnten im Euroraum inflationär wirken, sollte die EU gegenseitige Zölle einführen. Die Inflationsraten werden zudem künftig stärker schwanken, bedingt durch den Klimawandel (z. B. Überschwemmungen und Dürren) und durch Klimaschutzmaßnahmen (z. B. CO2-Bepreisung; siehe dazu OeNB-Blog vom 22. Jänner 2024 ). Die Geldpolitik muss Schocks und deren Auswirkungen auf die Inflation sorgfältig beobachten. Auch aus diesem Grund ist eine vorsichtige Herangehensweise bei Zinssenkungen angeraten.
Drittens gibt es große Unsicherheit über den neutralen Leitzins. Bei einem neutralen Leitzinsniveau werden die Wirtschaftsleistung und damit die Inflation weder angeschoben noch gedrosselt. Die Leitzinsen wirken also neutral auf Wirtschaft und Preisentwicklung. Allerdings sind Schätzungen zum neutralen Leitzins unsicher. Aktuell liegen sie zwischen 1,5 % und 3 %. Geht man vom oberen Wert aus, so hat die Geldpolitik im Euroraum bereits das neutrale Niveau erreicht. Um den unteren Wert zu erreichen, müssten noch einige Zinssenkungen folgen. Auch diese Unsicherheit spricht für bedächtige Zinssenkungen.
Der EZB-Rat entschied daher über Leitzinsänderungen von Sitzung zu Sitzung. Der angemessene geldpolitische Kurs orientierte sich an der jeweiligen Datenlage. Zum einen, damit die Wirkung der bisherigen Zinssenkungen abgeschätzt werden konnte. Und zum anderen, damit neue Entwicklungen berücksichtigt werden konnten. Der EZB-Rat legte sich folglich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest.
Die Konjunktur im Euroraum soll sich 2025 und 2026 laut der Prognose des Eurosystems vom Dezember 2024 leicht erholen. Konkret wird ein reales BIP-Wachstum von 1,1 % (2025) vorhergesagt, das in den Jahren 2026 und 2027 auf 1,4 % bzw. 1,3 % zulegen soll. Es wird folglich erwartet, dass die Wirtschaft mit einem Tempo wachsen wird, das in etwa dem Potenzialwachstum entspricht.
Österreichs Wirtschaft entwickelt sich derzeit schwächer als der Euroraum. Der folgende Kasten geht auf die wirtschaftliche Situation in Österreich ein.
Österreichs Wirtschaft war 2024 in einer Rezession
Die österreichische Wirtschaft befand sich auch 2024 in einer hartnäckigen Rezession. Seit dem zweiten Halbjahr 2022 schrumpft die Wirtschaftsleistung im Vorquartalsvergleich. Im Vergleich zur großen Rezession 2009 und dem Corona-Schock 2020 ist der Rückgang zwar vergleichsweise gering. Allerdings dauert die aktuelle Schwächephase bereits deutlich länger. Erstmals seit 1945 schrumpft die österreichische Wirtschaftsleistung zwei Jahre in Folge (2023: —0,8 %; 2024: —1,0 %; saison- und arbeitstägig bereinigt). Im Gegensatz dazu verzeichnete der Euroraum leicht positive Jahreswachstumsraten. Ausgelöst wurde die anhaltende Rezession in Österreich nicht durch ein einzelnes Ereignis. Vielmehr wirkten unterschiedliche Faktoren zusammen:
- Auslaufen von expansiven Politikmaßnahmen und Aufholeffekten nach dem Ende der COVID-19-Pandemie,
- reale Einkommens- und Vermögensverluste sowie negative Vertrauenseffekte infolge des Inflationsschocks,
- Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und gestiegene Finanzierungskosten infolge höherer Zinsen und
- Herausforderungen durch den strukturellen Wandel (z. B. Autoindustrie, umweltfreundliche Technologien, Tourismus).
Angebotsseitig erklärt sich der Rückgang überwiegend durch eine schrumpfende Sachgütererzeugung. Aber auch der Handel und Bau tragen maßgeblich zum Schrumpfen bei. Nachfrageseitig wird die Schwäche durch erhebliche Verluste an Marktanteilen im Außenhandel sowie einen starken Rückgang der Investitionen bestimmt. Der private Konsum wird von Unsicherheiten gedämpft und liefert trotz Reallohnzuwächsen keinen Beitrag zum Wachstum (im Gegensatz zum Euroraum wurden die seit Anfang 2021 bestehenden Reallohnverluste in Österreich durch Lohnerhöhungen mehr als ausgeglichen).
Ab 2025 erwartet die OeNB eine moderate Erholung (siehe Gesamtwirtschaftliche Prognose vom Dezember 2024 ). 2025 soll das BIP um 0,8 % wachsen, 2026 um 1,6 %. In dieser Prognose blieb jedoch ein deutliches Abwärtsrisiko unberücksichtigt: die notwendige Budgetkonsolidierung. Die Neuverschuldung 2025 und 2026 liegt ohne Konsolidierungsmaßnahmen bei rund 4 % des BIP laut OeNB. Die Rückführung auf eine EU-konforme Höhe (max. 3 % des BIP) wird den Ausblick jedenfalls dämpfen — genauso wie mögliche Handelshemmnisse, die ausgehend von den USA im Raum stehen.
Rezession in der Industrie bremst wirtschaftliche Erholung in CESEE und
Inflation stagniert
Das reale Wirtschaftswachstum in den EU-Mitgliedstaaten Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) beschleunigte sich 2024 etwas und lag im Durchschnitt bei 2 %. 2023 hatte es noch 0,7 % betragen.
Insbesondere der private Konsum trug zur Erholung der Wirtschaftstätigkeit bei. Die Konsumausgaben stiegen aufgrund höherer Realeinkommen und einer robusten Arbeitsmarktlage. Letztere zeichnete sich v. a. durch konstant niedrige Arbeitslosenraten und eine moderat zunehmende Beschäftigung aus. Darüber hinaus unterstützen auch steigende öffentliche Ausgaben die Konjunktur in einigen Ländern.
Die Industrie befindet sich hingegen seit Anfang 2023 durchgehend in der Rezession. Das schlägt sich aufgrund der starken Exportorientierung des Sektors einerseits in einem schwächeren Außenbeitrag zum BIP-Wachstum nieder. Andererseits wird dadurch auch die allgemeine Wirtschaftsstimmung getrübt.
Der rasche Rückgang der Inflation, den die CESEE-Region seit Anfang 2023 erlebt hatte, kam im Jahr 2024 zum Stillstand. Die durchschnittliche Teuerung bewegte sich im zweiten Halbjahr 2024 konstant zwischen 3,5 % und 4 %. Verantwortlich dafür waren eine Reihe von Sondereffekten, die sich v. a. auf die Energie- und Lebensmittelpreise auswirkten, sowie anhaltend starker Preisdruck aus dem Dienstleistungssektor. Rückläufig war hingegen die Teuerung bei Industriegütern. Vor diesem Hintergrund senkten die meisten Notenbanken der Region ihre Leitzinssätze zwar weiter, gingen dabei im zweiten Halbjahr 2024 aber etwas vorsichtiger vor also noch zu Jahresbeginn.
Die Gewinne in den CESEE-Bankensektoren entwickelten sich auch 2024 positiv. Mehrere CESEE-Bankensektoren verzeichneten sogar eine historisch starke Ertragslage. Darin spiegelte sich nicht nur die robuste Lage im Privatkund:innengeschäft wider, sondern auch die hohe Qualität der vergebenen Kredite: Von Letzteren konnte nur ein sehr kleiner Anteil nicht bedient werden. Auch die Zinsmargen waren 2024 hoch. Das heißt: Die Banken verlangten deutlich höhere Zinsen für Kredite als sie für bei ihnen eingelegte Gelder wie Tages- oder Festgeld zahlten.
IWF: Entwicklungen im Jubiläumsjahr
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat das Ziel, die Stabilität des internationalen Finanz- und Währungssystems zu sichern. Die OeNB hält die IWF-Anteile (Quote) für die Republik Österreich und vertritt Österreich im IWF-Gouverneursrat. In diesem Gremium ist OeNB-Gouverneur Robert Holzmann als IMF Governor vertreten. Die Funktion des IMF Alternate Governor für Österreich bekleidete bis November 2024 OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. Im Dezember 2024 übernahm OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger. Die laufende Geschäftsführung des IWF obliegt dem Exekutivdirektorium, dem 25 Direktor:innen angehören. Einige Direktor:innen vertreten dort Mitgliedstaaten, die über einen ständigen Sitz verfügen (USA, Japan, China, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Russland, Saudi-Arabien). Alle weiteren Direktor:innen vertreten jeweils mehrere Mitgliedsländer, die in Stimmrechtsgruppen zusammengefasst sind. Österreich befindet sich mit der Türkei, Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Slowenien und Kosovo in einer gemeinsamen Stimmrechtsgruppe. Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2026 stellt die Türkei den Exekutivdirektor dieser Stimmrechtsgruppe und Österreich den Stellvertretenden Exekutivdirektor.
2024 gab es Grund zum Feiern. Zum einen sind seit der Gründung des IWF und der Weltbank 80 Jahre vergangen. Zum anderen ist Österreich seit 75 Jahren Mitglied beim IWF. Aus diesem Anlass organisierten die OeNB und das Bretton Woods Committee in Wien eine internationale Konferenz. Sie wurde per Video-Zuschaltung durch die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, eröffnet. Kernstück der Konferenz waren drei hochrangige Podiumsdiskussionen. Diese behandelten die sich verändernde Rolle des IWF, den ökologischen Wandel und die Entwicklung der Kapitalflüsse. Eine Zusammenfassung dieser Diskussionen findet sich hier: „ Bretton Woods @ 80 and Austria’s IMF Membership @ 75 — Occasional Paper No. 5 “.
Das Who‘s Who der Wirtschafts- und Finanzwelt tagte wie üblich im April und im Oktober in Washington, D.C. Österreich gab dort ein Statement für die Stimmrechtsgruppe im Internationalen Währungs- und Finanzausschuss (International Monetary and Finance Committee — IMFC) ab. Dieser Ausschuss verabschiedet gewöhnlich ein Communiqué, das als Leitfaden des Arbeitsprogramms des IWF dient. Jedoch konnten sich die Vertreter:innen im Oktober 2024 mittlerweile zum sechsten Mal auf kein IMFC-Communiqué einigen. Grund dafür sind die unterschiedlichen Sichtweisen zu den internationalen Konflikten.
In Österreich trat 2024 das IWF-Quotenerhöhungsgesetz in Kraft. Dadurch kann sich Österreich an der 16. Allgemeinen Quotenerhöhung des IWF beteiligen. Diese Reform kann in Kraft treten, sobald ausreichend Mitgliedsländer zugestimmt haben. Die Quoten der IWF-Mitgliedstaaten würden dann proportional um 50 % steigen. Übergangsmaßnahmen sollen bis zum Inkrafttreten der Reform die Kreditvergabekapazität des IWF in unveränderter Höhe erhalten. So wurde u. a. die Teilnahme Österreichs an den Neuen Kreditvereinbarungen (New Arrangements to Borrow — NAB) von 2026 bis 2030 verlängert. Zudem wurde die Laufzeit des bilateralen Darlehens der OeNB mit dem IWF bis längstens 31. Dezember 2027 verlängert.
Weiters besuchte der IWF Österreich 2024 wieder zwei Mal. Im Rahmen der „Artikel-IV-Konsultation“ Ende Februar fokussierte die IWF-Delegation auf Diskussionen zur nachhaltigen Erholung der Wirtschaft. Beim Besuch im September lag der Schwerpunkt auf Diskussionen zur robusten wirtschaftlichen Erholung, dem nachhaltigen Rückgang der Inflation und einem mittelfristig höheren Wachstum.
Auch 2025 plant der IWF, wieder eine Artikel-IV-Konsultation durchzuführen. Ebenso soll der IWF, wie zuletzt 2019, eine umfassende verpflichtende Überprüfung des österreichischen Finanzsektors im Rahmen des Financial Sector Assessment Program (FSAP) vornehmen.
Geldpolitische Operationen belasten das geschäftliche Ergebnis der OeNB
Auf Jahre der Krisenmaßnahmen (2015—2022) folgt Abbau der
Notenbankbilanz
Der Euroraum war seit 2008 mehreren Krisen ausgesetzt: der Wirtschafts- und Finanzkrise, einer Staatsschuldenkrise sowie der COVID-19-Pandemie. Diese Krisen trugen jeweils auch die Gefahr für deflationäre Entwicklungen in sich. Daher reagierte die Geldpolitik im Euroraum nicht nur mit Senkungen der Leitzinsen, welche bereits um oder knapp unter 0 % lagen, sondern auch mit Wertpapier-Ankaufprogrammen und längerfristigen Refinanzierungsgeschäften. Folglich weiteten sich die Bilanzen der Notenbanken im Euroraum, darunter jene der OeNB, deutlich aus.
Um sich für künftige Krisen zu rüsten und Spielraum für neue Kriseninstrumente zu schaffen, ist es wichtig, die Bilanzgröße in Nicht-Krisenzeiten abzubauen. Und genau das passiert seit einiger Zeit: 2023 wurde die konsolidierte Bilanz des Eurosystems um etwas mehr als 1 Billion EUR reduziert. 2024 wurden insbesondere die geldpolitischen Kriseninstrumente stark reduziert. Ihr Bilanzwert nahm 2024 sogar um ¾ Billion EUR ab. Da jedoch der Wert anderer Bilanzaktiva zunahm, wie z. B. von Gold und Goldforderungen, schrumpfte die Bilanz insgesamt nur um ½ Billion EUR.
Die gewichtigste Rolle im bisherigen Bilanzabbau spielten die Rückzahlungen der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTROs III). Dieses bereits vor der COVID-19-Pandemie bestehende Instrument wurde für die Corona-Ausnahmesituation adaptiert. Banken konnten sich daraufhin zu sehr günstigen Konditionen für maximal drei Jahre Geld vom Eurosystem leihen. Die Geschäfte waren mit einem begünstigten Zinssatz verknüpft, sofern die Banken die Mittel als Kredite an die Realwirtschaft weitergaben. Die Nachfrage war v. a. 2020 groß. Insgesamt nahmen Banken in dieser TLTRO-III-Serie im Eurosystem 2.206 Mrd EUR an Liquidität auf; davon entfielen 87 Mrd EUR auf österreichische Banken. Nach drei Jahren Laufzeit waren die Rückflüsse v. a. 2023 mit 925 Mrd EUR hoch. Doch auch 2024 flossen noch 392 Mrd EUR ans Eurosystem zurück. Die letzte Tranche wurde im Dezember 2024 zurückgezahlt, womit das Kapitel der TLTROs III endgültig geschlossen wurde.
Auch die Wertpapier-Ankaufprogramme reifen nunmehr ab. Beim Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (Asset Purchase Programme — APP) endete die aktive Ankaufsphase Mitte 2022. Bis Mitte 2023 wurden auslaufende Wertpapiere teilweise reinvestiert. Seither reifen die APP-Wertpapiere vollständig ab. Bei Laufzeitende werden sie getilgt und verschwinden aus der Notenbankbilanz.
Beim Pandemie-Notfallankaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme — PEPP) wurde zwischen März 2020 und März 2022 aktiv angekauft. Bis Mitte 2024 wurden auslaufende Wertpapiere vollumfänglich wiederveranlagt. In der zweiten Jahreshälfte reduzierte sich das PEPP-Portfolio im Eurosystem durch eine nur teilweise Reinvestition um monatlich 7,5 Mrd EUR. Ende 2024 wurde die Wiederanlage der PEPP-Tilgungsbeträge eingestellt und seither reifen auch diese Wertpapiere vollständig ab.
2024 nahm der Bestand an APP- und PEPP-Wertpapieren daher um 365 Mrd EUR ab. Dies entspricht in etwa 8 % des Gesamtbestands im Eurosystem, der Ende 2024 bei rund 4,5 Billionen EUR lag. Würde sich der Abbau in den nächsten Jahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit fortsetzen, würde das Portfolio bis 2030 auf die Hälfte schrumpfen. Mit anderen Worten: Die im Rahmen der Krisenmaßnahmen angekauften Wertpapiere werden noch längere Zeit in den Bilanzen des Eurosystems bleiben.
Den geldpolitischen Geschäftspartnern in Österreich wie im Euroraum stehen weiterhin die Standard-Refinanzierungsinstrumente zur Verfügung. Die Hauptrefinanzierungsgeschäfte werden wöchentlich mit einer Laufzeit von sieben Tagen durchgeführt. Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte werden monatlich mit einer Laufzeit von drei Monaten angeboten. Es ist damit zu rechnen, dass diese Standardoperationen in Zukunft wieder stärker in Anspruch genommen werden, da diese eine zentrale Rolle bei der Deckung des Liquiditätsbedarfs der Banken spielen.
Änderungen bei der Verzinsung der Standard-Refinanzierungsinstrumente
Seit Juni 2024 wurden die drei Leitzinssätze der EZB bis Redaktionsschluss in fünf Schritten gesenkt. Der Zinssatz für die Einlagefazilität wurde um insgesamt 125 Basispunkte verringert. Dieser Zinssatz ist im aktuellen Umfeld für die Geldmarktzinsen maßgeblich. Zusätzlich beschloss der EZB-Rat, den Zinsabstand (Spread) zwischen Hauptrefinanzierungssatz und Einlagesatz per 18. September 2024 von 50 auf 15 Basispunkte zu verringern. Konkret wurden der Hauptrefinanzierungssatz und der Spitzenrefinanzierungssatz im Jahresverlauf 2024 bis Redaktionsschluss um insgesamt 160 Basispunkte gesenkt. Der verringerte Spread soll die Kosten für eine Aufnahme von Liquidität im Eurosystem senken und die Volatilität, d. h. die Schwankung, der Zinssätze am Geldmarkt begrenzen. Aufgrund der nach wie vor hohen Überschussliquidität lagen die Zinsen am Interbankenmarkt im Verlauf des Jahres 2024 weiterhin unter dem Einlagesatz.
Wie will das Eurosystem die Geldmarktzinsen in Zukunft steuern?
Das operationale Rahmenwerk wurde angesichts der auslaufenden Krisenmaßnahmen überprüft. Im März 2024 wurde der neue geldpolitische Handlungsrahmen beschlossen. Eine neuerliche Überprüfung soll anhand der Entwicklung der Marktaktivität und Überschussreserven 2026 erfolgen. Der EZB-Rat entscheidet in seinen Zinssitzungen (alle sechs Wochen) immer über die drei Leitzinssätze: (1) den Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität, zu dem sich Banken Geld über Nacht gegen Sicherheiten (Wertpapiere) leihen können; (2) den Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte zur Aufnahme von Liquidität und (3) den Zinssatz für die Einlagefazilität, der für die Einlagen von Banken bei den Notenbanken des Eurosystems gilt. Der erst- und letztgenannte Zinssatz bilden einen sogenannten Korridor um den Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte.
Mithilfe dieses Leitzinskorridors steuert das Eurosystem kurzfristige Geldmarktzinsen. Das sind jene Zinsen, die sich Banken gegenseitig verrechnen, wenn sie einander kurzfristig, also über Nacht, Geld leihen. Der Leitzinskorridor gibt somit den Rahmen vor, in dem sich die Übernachtzinsen am Interbankenmarkt (Euro Short-Term Rate — €STR) bewegen. Wo genau sich dieser Interbankenzinssatz innerhalb des Korridors befindet, hängt vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage nach Zentralbankreserven ab. Nur wenn es dem Eurosystem gelingt, genauso viele Reserven in Umlauf zu bringen, wie die Banken nachfragen, wird der Geldmarktzins genau in der Mitte des Korridors liegen.
Die große Menge an Überschussreserven ist auf die Krisenmaßnahmen der letzten Jahre zurückzuführen. Seit 2015 orientieren sich daher kurzfristige Geldmarktzinsen am unteren Rand des Leitzinskorridors. Durch das Auslaufen dieser Maßnahmen — insbesondere das Abreifen der Anleihen-Portfolios APP und PEPP — wird in den nächsten Jahren das Reservevolumen (und somit die Eurosystem-Bilanz) zurückgehen. In der Folge werden die Geldmarktzinsen innerhalb des Korridors steigen. Dies könnte mit höheren Schwankungen dieser kurzfristigen Zinsen einhergehen. Deshalb wurde der Leitzinskorridor zwischen der Spitzenrefinanzierungsfazilität am oberen Ende des Korridors und dem Einlagezinssatz am unteren Ende verengt — von 75 auf 40 Basispunkte. Somit können mögliche Schwankungen innerhalb eines engeren Korridors abgemildert werden.
Bis zur neuerlichen Überarbeitung des operationalen Handlungsrahmens des Eurosystems 2026 soll der Mix an geldpolitischen Instrumenten das Rahmenwerk robust machen. Zum Instrumentarium zählen kurzlaufende Refinanzierungsgeschäfte (Hauptrefinanzierungsgeschäft und längerfristiges Refinanzierungsgeschäft mit drei Monaten Laufzeit). Wenn sich die Eurosystem-Bilanz wieder ausweiten sollte, werden neue strukturelle längerfristige Refinanzierungsgeschäfte und ein strukturelles Portfolio mit Wertpapieren des Euroraums eingeführt.
Mindestreserven werden mit 0 % verzinst
Mindestreserven sind Guthaben, die Banken beim Eurosystem bzw. der OeNB halten müssen. 2024 hielten österreichische Geschäftsbanken im Durchschnitt rund 4,7 Mrd EUR auf ihren Mindestreservekonten bei der OeNB. Per 20. September 2023 wurde die Verzinsung dieser Mindestreserven auf 0 % gesenkt, um die Geldpolitik für das Eurosystem effizienter zu gestalten.
Liquiditätsversorgung in US-Dollar
Neben den liquiditätszuführenden Refinanzierungsgeschäften in Euro führt das Eurosystem auch weiterhin wöchentliche Tenderoperationen in US-Dollar mit einer Laufzeit von einer Woche durch. Zur Versorgung mit USD-Liquidität bei etwaigen Engpässen können die Laufzeiten bzw. auch die Anzahl dieser USD-Tenderoperationen angepasst werden.
2024 wurden die USD-Tenderoperationen wöchentlich angeboten. Insgesamt wurden dem Eurosystem 8,9 Mrd USD zugeteilt. Österreichische Banken nahmen davon ca. 10 % in Anspruch.
Ungleichgewicht zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag führt zu
Bilanzverlust und negativem Eigenkapital
Für 2024 weist die OeNB ein negatives geschäftliches Ergebnis von 2,1 Mrd EUR aus. Daraus resultiert ein Bilanzverlust von 4,2 Mrd EUR, welcher den Bilanzverlust aus dem Vorjahr von 2,1 Mrd EUR (als
Verlustvortrag) enthält. Das Ergebnis wird ins Jahr 2025 fortgeschrieben. Der Verlust entstand wieder aus dem negativen Zinsergebnis der Geldpolitik, das von denselben Faktoren wie 2023 geprägt wurde.
Im Jahresdurchschnitt 2024 betrugen die Einlagen österreichischer Kreditinstitute bei der OeNB 87,3 Mrd EUR. Sie wurden mit dem Zinssatz für die Einlagefazilität verzinst. Dieser Zinssatz sank von 4,0 % zu Jahresbeginn auf 3,0 % zum Jahresende 2024. Im Durchschnitt musste die OeNB deshalb 3,7 % Zinsen an die Kreditinstitute leisten.
Demgegenüber standen Zinserträge aus Wertpapieren für geldpolitische Zwecke, die das Eurosystem als Reaktion auf vorangegangene Krisen gekauft hatte. Im Durchschnitt befanden sich 106,6 Mrd EUR in der OeNB-Bilanz. Der Großteil davon war in einer Phase der Niedrigzinspolitik angekauft worden, d. h. mit Zinsen nahe bei 0 % oder negativen Zinsen.
Das Ungleichgewicht zwischen Zinsaufwand und Zinsertrag führte zwangsläufig insgesamt zu einem Verlust. Erträge aus der eigenen Veranlagung der OeNB wirkten aber auch im Berichtsjahr positiv auf das Ergebnis. Trotzdem kann die OeNB aufgrund ihres Verlusts 2024 keine Dividende an den Staat Österreich ausschütten.
Der Verlustvortrag wird in der Zukunft durch Gewinne wieder abgebaut. Die OeNB orientiert sich dabei am Konvergenzbericht der EZB: Laut diesem Bericht soll vermieden werden, dass das Eigenkapital einer Zentralbank über einen längeren Zeitraum hinweg negativ ist. Das bedeutet, dass zuerst der Verlustvortrag abgebaut wird, bevor wieder Reserven gebildet werden oder eine Dividende an den Staat ausgeschüttet wird.
Der Bilanzverlust wird ab 2024 auf der Passivseite der Bilanz als negativer Betrag dargestellt, weil die Vorschriften für die Bilanzierung im ESZB im Jahr 2024 geändert wurden. Dadurch verringert sich die Bilanzsumme der OeNB. Die neue Darstellung erhöht die Transparenz für die Leser:innen. 2023 wurde der Bilanzverlust auf der Aktivseite ausgewiesen.
Erstmals negatives Eigenkapital
Der Bilanzverlust 2024 ist höher als das Grundkapital und die Rücklagen. Deshalb haben wir heuer zum ersten Mal ein negatives Eigenkapital. Was bedeutet das für eine Zentralbank? Ein negatives Eigenkapital schränkt Zentralbanken in ihrem Handeln nicht ein. Die OeNB kann auch mit negativem Eigenkapital weiterhin alle Aufgaben im Rahmen des ESZB erfüllen. Die Effektivität der Geldpolitik und die Unabhängigkeit der Zentralbank bleiben weiterhin bestehen.
Wie wird sich das Ergebnis der OeNB entwickeln?
Aufgrund der langen Laufzeiten des geldpolitischen Portfolios reift dieses nur langsam ab. Dementsprechend werden auch die Einlagen der Kreditinstitute nur langsam abgebaut. Ab 2025 dürfte sich das Ergebnis aus der Geldpolitik verbessern. Es wird aber über die nächsten Jahre voraussichtlich negativ bleiben. Darum wird die OeNB auch in den folgenden Jahren ein negatives Eigenkapital haben. Künftige Gewinne werden auf mittlere bis lange Sicht die Verlustvorträge und damit das negative Eigenkapital wieder ausgleichen.
Gute Entwicklung an den Finanzmärkten bringt positives Veranlagungsergebnis im Reservemanagement
Der aus der Geldpolitik resultierte Bilanzverlust im Geschäftsjahr 2023 führte zu einem Abschmelzen der OeNB-Risikodeckungsmassen, d. h. des Kapitals, das zur Risikoabsicherung verfügbar ist. Vor diesem Hintergrund entschied das Direktorium der OeNB, 2024 das Risiko zu reduzieren und das Veranlagungsvolumen im Reservemanagement entsprechend anzupassen. Die Wertsteigerungen der OeNB-Veranlagungen hatten einen positiven Einfluss auf unsere Bilanz.
Die Veranlagung der Reserven unterliegt einem umfangreichen Risikomanagement und Kontrollsystem. Dabei achten wir insbesondere auf hohe Liquidität und Sicherheit, damit Mittel für koordinierte Interventionen an den Finanzmärkten verfügbar sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Diversifikation (Grafik 4), wobei Gold rund 64 % der Reserven ausmacht. Darüber hinaus setzt die OeNB auf einen Anlagemix in unterschiedlichen Währungen und Regionen — v. a. Schuldverschreibungen (rund 29 %), aber auch Aktien (rund 7 %). Die Diversifikation in Unternehmensanleihen und Aktien verbessert das Risiko-Ertrags-Verhältnis. Es überwiegen konvertible Währungen von Staaten mit hohen Bonitätsbewertungen sowie Anleihen von Staaten, staatsnahen Agenturen und supranationalen Organisationen und besicherte Schuldverschreibungen. Diese Strategie sorgt seit Jahren für Stabilität.
Entwicklung der Finanzmärkte führt zu gutem OeNB-Veranlagungsergebnis
2024 erzielten sowohl die Anleihen- als auch die Aktienmärkte eine positive Wertentwicklung. Die Stimmung an den Finanzmärkten zeigte sich durchwegs freundlich. Der Grund: insbesondere rückläufige Inflationsraten, sinkende Leitzinsen und robuste Unternehmensergebnisse.
An den Aktienmärkten sticht die sehr starke Wertentwicklung des US-Markts hervor. Der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 stieg mit +23,3 % deutlich stärker als der Euroraum-Index EURO STOXX 50 mit +8,3 % (Grafik 5). Der österreichische ATX stieg um 6,6 %. Der US-Aktienmarkt profitierte einerseits von der anhaltend starken Entwicklung des Technologiesektors sowie in der zweiten Jahreshälfte 2024 verstärkt vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl. Die Investoren versprechen sich davon Deregulierungen und Steuererleichterungen für US-Unternehmen.
Die Märkte für Staatsanleihen profitierten u. a. von den Zinssenkungen der großen westlichen Notenbanken. Deutsche und US-Staatsanleihen mit einer Duration von über sieben bzw. knapp sechs Jahren stiegen im Wert über den Jahresverlauf ähnlich stark (jeweils +0,6 %). Österreichische Staatsanleihen mit einer Duration von rund 8,5 Jahren konnten um 1,9 % zulegen.
Der Euro verlor 2024 gegenüber dem US-Dollar und dem Pfund Sterling an Wert. Im Vergleich zur US-amerikanischen Notenbank und der Bank of England senkte die EZB nämlich rascher als erwartet die Leitzinsen. Der US-Dollar bekam durch die Wahl von Donald Trump zusätzlich Rückenwind und legte über das Jahr 2024 gegenüber dem Euro um 6,7 % zu. Das Pfund Sterling wertete um 4,9 % gegenüber dem Euro auf, da sich die Geldpolitik der Bank of England über den Jahresverlauf restriktiver zeigte als zunächst erwartet. Der japanische Yen hingegen verlor gegenüber dem Euro 4,4 %. Letzteres ist v. a. auf die Geldpolitik der Bank of Japan zurückzuführen: Sie ist nach wie vor vergleichsweise expansiv.
Nachhaltiges Investieren gewinnt weiter an Bedeutung
In der OeNB berücksichtigen wir im Reservemanagement bereits seit vielen Jahren Nachhaltigkeitskriterien. Seit 2011 müssen für uns tätige externe Vermögensverwalter Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für nachhaltiges Investieren sein (Principles for Responsible Investment). Diese Prinzipien umfassen die ESG-Aspekte Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Die OeNB wird — wie bereits im Vorjahr — klimarelevante Aspekte ihrer nicht geldpolitischen Portfolios veröffentlichen (siehe Berichte „ Klimabezogene Finanzberichterstattung - Oesterreichische Nationalbank (OeNB) “).
OeNB leistet aktiven Beitrag zur Finanzmarktstabilität
Österreichischer Bankensektor in einem herausfordernden Umfeld
Die österreichischen Banken entwickelten sich auch 2024 positiv, trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds in Österreich. Die historisch hohe Profitabilität ist maßgeblich auf das verbesserte Zinsergebnis im Inland und die günstige Entwicklung in Zentral, Ost- und Südosteuropa zurückzuführen (CESEE inkl. Russland). Das Zinsergebnis umfasst auch Zinseinnahmen aus der Veranlagung von Überschussliquidität bei der OeNB. Der Gewinn belief sich im dritten Quartal 2024 auf 10,7 Mrd EUR und ging damit im Vergleich zum Rekordjahr 2023 nur leicht zurück. Die günstige Gewinnsituation wurde für den weiteren Kapitalaufbau und damit zur Stärkung der Resilienz genutzt. Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) erreichte im dritten Quartal 2024 17,5 % und lag damit über dem europäischen Durchschnitt. Auch die Liquiditätsausstattung der Banken blieb solide, trotz rückläufiger Zentralbank-Liquidität.
Der jährliche OeNB-Stresstest attestierte 2024 dem österreichischen Bankensystem eine solide Risikotragfähigkeit. Er verdeutlichte, wie wichtig eine gute Ausgangskapitalisierung gerade in herausfordernden Zeiten ist. Das Szenario, auf dem der Stresstest basierte, unterstellte eine globale Rezession, sinkende Inflation und Zinsen sowie anhaltende geopolitische Risiken. Die Ergebnisse zeigten, dass die harte Kernkapitalquote des Bankensystems über drei Jahre um 5,2 Prozentpunkte auf 12,2 % zurückgeht. Erstmals wurden im Stresstest auch dynamische Effekte wie Kreditwachstum und Bankreaktionen berücksichtigt. Das Fazit: Gut kapitalisierte Banken können auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine adäquate Kreditversorgung der Volkswirtschaft gewährleisten.
Die Kreditqualität verschlechterte sich 2024 weiter (Grafik 6). Dafür sind das höhere Zinsniveau und die schwache Konjunktur in Österreich hauptverantwortlich. Der Anteil der notleidenden Kredite (NPL) an den Gesamtkrediten stieg auf 2,8 % (drittes Quartal 2024), wobei v. a. Kredite an kleine und mittlere Unternehmen sowie gewerbliche Immobilienkredite (jeweils über 5 %) im Inland herausstechen. Die Kreditqualität der Tochterbanken in CESEE hat sich hingegen kaum verändert.
Externe Einschätzungen bestätigen die Resilienz des österreichischen Bankensystems
Die Bemühungen der Banken und aufsichtliche Maßnahmen (wie höhere Kapitalisierung und gute Kreditvergabestandards) konnten die Finanzmarktstabilität in Österreich effektiv stärken. Auch internationale Institutionen wie der IWF sehen die österreichischen Banken in einer resilienten Verfassung. Bewertungen durch Ratingagenturen bestätigen dies. Das österreichische Einlagensicherungssystem erwies sich 2024 bei einem Einlagensicherungsfall als effektiv und stabil. Auf einer Fachkonferenz der OeNB wurde im September 2024 bestätigt, dass die aktuell hohen Unsicherheiten und geopolitischen Risiken eine entsprechende Resilienz erfordern. Zudem ist ein funktionierendes Einlagensicherungssystem essenziell für das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsystems. Gerade in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld ist dies von besonderer Bedeutung.
Aufsicht trägt zur Resilienz des österreichischen Bankensektors bei
Zielgerichtete makroprudenzielle Maßnahmen wie Standards zur nachhaltigen Kreditvergabe und Kapitalpuffer trugen 2024 weiterhin dazu bei, die Finanzmarktstabilität zu wahren und systemische Risiken, d. h. Risiken für das Finanzsystem im Ganzen, zu mindern.
Die Kreditvergabestandards für neue Wohnimmobilienfinanzierungen haben sich seit der Einführung der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) Mitte 2022 deutlich verbessert. Dank der Wirksamkeit der KIM-V und der gestiegenen Kapitalisierung stellte die OeNB 2024 fest, dass kein erhöhtes Systemrisiko für das österreichische Finanzsystem mehr besteht. Für diesen Fall sieht das Gesetz ein Auslaufen der Verordnung vor (per 30. Juni 2025). Dennoch ist es wichtig, dass Anreize gesetzt werden, um das gute Niveau der Vergabestandards abzusichern und mit den Anforderungen der KIM-V konsistent zu halten. Verbindliche Vergabestandards sind mittlerweile international üblich.
2024 wurde ein sektoraler Systemrisikopuffer beschlossen, der auf Risiken abzielt, die von der gewerblichen Immobilienfinanzierung für das Finanzsystem ausgehen. Diese Risiken hängen von der Art und Höhe der Besicherung, der Ausgestaltung der Kredite (z. B. Endfälligkeit) sowie der Geschäftsmodelle der Unternehmen ab. In Österreich machen gewerbliche Immobilienfinanzierungen einen großen Anteil an der Bilanzsumme österreichischer Banken aus. Vor diesem Hintergrund stellte das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) auf Basis von Analysen der OeNB Folgendes fest: Falls sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschlechtert, können potenzielle Verluste aus gewerblichen Immobilienkrediten ein erhöhtes Risiko für die Finanzmarktstabilität darstellen. Das FMSG hat daher der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) empfohlen, per Mitte 2025 einen sektoralen Systemrisikopuffer von zunächst 1 % (in hartem Kernkapital, CET1) einzuführen.
Strukturelle makroprudenzielle Kapitalpuffer stärken die Resilienz des Bankensektors. Der Systemrisikopuffer dient zur Abdeckung von Systemrisiken, die auf die einzelne Bank wirken. Der Kapitalpuffer für andere systemrelevante Institute (kurz O-SII-Puffer) gilt für Banken, die ein Systemrisiko für das System darstellen können. Diese strukturellen Systemrisiken des österreichischen Bankensystems haben sich in den letzten zwei Jahren nicht wesentlich verändert. Für einige wenige Banken änderte sich die Höhe des O-SII-Puffers insbesondere aufgrund des Abschlusses der Einschleifphase. Die Höhe des Systemrisikopuffers blieb hingegen unverändert. Zudem wurde beim O-SII-Puffer die Berechnungs-Methodik so angepasst, dass stärker zwischen Banken unterschiedlicher systemischer Relevanz differenziert wird.
Die Höhe des antizyklischen Kapitalpuffers von 0 % wurde beibehalten, da kein übermäßiges Kreditwachstum — im Verhältnis zur Wirtschaftsentwicklung — festgestellt wurde.
Diesbezügliche Detailanalysen werden im halbjährlich erscheinenden OeNB Financial Stability Report veröffentlicht.
Zehn Jahre makroprudenzielle Aufsicht und Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) in Österreich
Das FMSG wurde 2014 gegründet, um die Stabilität des Finanzmarkts in Österreich zu stärken und systemische Risiken zu minimieren. Es besteht aus Vertreter:innen des BMF, der OeNB, der FMA und des Fiskalrats. Die OeNB spielt dabei eine zentrale Rolle, indem sie makroprudenzielle Analysen durchführt und systemische Risiken bewertet. Sie schlägt Maßnahmen vor und entwirft die entsprechenden Empfehlungen des Gremiums an die FMA. Zudem ist in der OeNB das Sekretariat des FMSG eingerichtet.
In den letzten zehn Jahren hat das FMSG wichtige Maßnahmen ergriffen und so das Risiko von Finanzkrisen verringert und die Finanzmarktstabilität gewährleistet: Der Systemrisikopuffer (SyRP) adressiert strukturelle Risiken im Finanzsystem und stärkt die Risikotragfähigkeit der Banken. Der O-SII-Puffer zielt darauf ab, das Risiko von großen, systemrelevanten Banken zu mindern. Der sektorale Systemrisikopuffer für Gewerbeimmobilienkredite stellt zusätzliches Kapital als Risikopuffer bereit, um potenzielle Verluste in Krisenzeiten abzudecken. Die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) von 2022 verbesserte die Kreditvergabestandards für Wohnimmobilienkredite und verhinderte somit den Aufbau systemischer Risiken.
Das FMSG hat damit dazu beigetragen, die Stabilität des österreichischen Finanzsystems auch in unsicheren Zeiten zu erhöhen — wie der COVID-19-Pandemie oder der Phase gestiegener Inflation und dem Ende des Niedrigzinsniveaus. Dadurch wurde das Vertrauen der Bevölkerung sowie internationaler Investoren gestärkt. Ein Meilenstein war das Upgrade des österreichischen Bankensektors in die zweitbeste Stufe des Banking Industry Country Risk Assessment von Standard & Poor’s im Jahr 2018. Kein Bankensystem befand sich in der besten Stufe. Eine solche ausgezeichnete Einstufung führt zu niedrigeren Refinanzierungskosten für Banken und damit auch für Unternehmen und Haushalte in Österreich.
Zehn Jahre einheitliche europäische Bankenaufsicht auch für Österreich ein Erfolg
2024 wurde der Einheitliche Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism — SSM) zehn Jahre alt. Der SSM fördert die Stabilität und Resilienz der europäischen Bankenlandschaft. So ist beispielsweise die Kapitalausstattung gemessen an der CET1-Quote der bedeutenden Institute im SSM seit 2014 von 11 % auf fast 16 % im dritten Quartal 2024 gestiegen, in Österreich stieg die CET1-Quote noch deutlicher (Grafik 7). Zudem erwiesen sich die Banken während der US-Regionalbankenkrise 2023, der Pandemie und der Energiekrise 2022 als krisenfest. Durch den massiven Abbau von notleidenden Krediten befinden sich die Banken in einer guten Ausgangslage, um mit den gestiegenen ökonomischen und geopolitischen Herausforderungen umzugehen. Durch die verbesserten Bilanzkennzahlen können die Banken den Auswirkungen des Klimawandels, der Cyberkriminalität und den Herausforderungen der Digitalisierung effektiv begegnen.
In Österreich übernehmen OeNB und FMA wesentliche Aufgaben im Bereich der Aufsicht über die bedeutenden Institute und haben die unmittelbare Zuständigkeit für weniger bedeutende Institute. Die Entscheidung, ob eine Bank als bedeutend gilt, basiert u. a. auf folgenden Kriterien: Bilanzsumme übersteigt 30 Mrd EUR, ökonomische Wichtigkeit im jeweiligen Land bzw. in der EU (drei größte Banken im Land) sowie grenzüberschreitende Tätigkeit. Per September 2024 werden SSM-weit 113 Institute als bedeutend eingestuft, wovon 6 ihren Hauptsitz in Österreich haben (Addiko Bank AG, BAWAG Group AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen und Volksbank Wien AG). Mit 1. Jänner 2025 ist darüber hinaus die österreichische Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien ein bedeutendes Institut.
Die operativen Tätigkeiten innerhalb des SSM werden durch europäische Aufsichtsteams, sogenannte Joint Supervisory Teams, gewährleistet. Für jedes bedeutende Institut gibt es ein solches Team. Neben der laufenden Beaufsichtigung werden im SSM Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt, Modellgutachten erstellt, bankenaufsichtliche Strategien und Richtlinien entwickelt sowie horizontale Querschnitts-Agenden unter einer gesamteuropäischen Perspektive wahrgenommen.
Fokus der Vor-Ort-Prüfungen 2024
Die Schwerpunkte der Vor-Ort-Prüfungen in Österreich lagen 2024 auf Kredit-, Liquiditäts- und Cyberrisiken. Das war den geopolitischen Spannungen und dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld geschuldet. Im Rahmen einer europaweit koordinierten Initiative wurde das Liquiditätsrisiko von Banken geprüft. Darüber hinaus wurde auf das Finanzierungsrisiko, die Notfallpläne sowie auf die Berechnung der regulatorischen Kennzahlen fokussiert.
Aufgrund des aktuellen Marktumfelds zeigten sich bei Gewerbeimmobilienfinanzierungen erhöhte Risiken und Kreditausfälle. Daher konzentrierten sich Prüfungen des Kreditrisikos besonders auf Gewerbeimmobilien sowie auf den internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS 9 (u. a. Bewertungen) und Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken). Die Ergebnisse zeigten Verbesserungsbedarf in den Risikomanagementsystemen der Banken, insbesondere bei der Erkennung und Bearbeitung problematischer Kredite.
Sicherstellung der Cyberresilienz für den Finanzplatz von zunehmender Bedeutung
Durch die rasch fortschreitende Digitalisierung im Finanzsektor werden IT-Risiken relevanter. 2024 wurden die Vorbereitungsarbeiten für die ab Jänner 2025 anwendbare EU-Verordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (kurz DORA-Verordnung) vorangetrieben. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors gegen Cyberbedrohungen und andere IT-Risiken zu stärken.
Zu dieser Vorbereitung zählt die Arbeit an TIBER-AT in Österreich. TIBER steht für „Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming“. Dabei simulieren „ethische“ Hacker (Red Team) unter streng kontrollierten Bedingungen einen möglichst realitätsnahen Cyberangriff auf ein Finanzunternehmen. Während einer Pilotphase im Jahr 2024 führte die OeNB in Kooperation mit der FMA erste TIBER-Tests bei österreichischen Finanzunternehmen durch. Diese Erfahrungen fließen nun in die Umsetzung der DORA-Verordnung ein. Letztere verpflichtet bestimmte Finanzunternehmen, ab 2025 „Threat-Led Penetration Testing“ durchzuführen. Solchen strukturierten Angriffssimulationen liegt das TIBER-Rahmenwerk als relevanter Standard zugrunde.
Die OeNB wirkte auch an dem von der EZB angesetzten SSM-weiten Stresstest zur Cyberresilienz mit, an dem alle österreichischen bedeutenden Institute teilnahmen. Dabei waren Banken mit einem Szenario konfrontiert, in dem die wichtigsten Systeme einer Bank (Kernbankensystem) durch einen Angriff ausgeschaltet wurden. Insgesamt zeigte der Stresstest, dass Banken über Reaktions- und Wiederherstellungsrahmen verfügen. Die Ergebnisse flossen in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) ein, der das Abschneiden der Banken sowie die individuellen Risikoprofile berücksichtigt. Der Stresstest half allen Beteiligten, sich der Stärken und Schwächen im Bereich der Cyberresilienz bewusster zu werden.
Schwerpunkte der Bankenaufsicht für 2025
Um weiterhin ein sicheres, stabiles und gut geführtes Banken- und Finanzsystem zu gewährleisten, legten OeNB und FMA ihre Aufsichtsschwerpunkte für 2025 wie folgt fest:
- Wahrung der Resilienz des Bankensektors mit Fokus auf Kredit- und Immobilienrisiken,
- Digitalisierung, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz,
- Klima- und Umweltrisiken und die damit einhergehende Transformation der Wirtschaft und
- Governance.
Diese vier Schwerpunkte stehen im Einklang mit den Aufsichtsschwerpunkten des SSM und dem Arbeitsprogramm der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority — EBA) für 2025.
Finalisierung der Basel-III-Reformagenda und weitere regulatorische Themen mit Relevanz für den österreichischen Finanzsektor
Das Bankenpaket 2021 ist ab Jänner 2025 in der EU anwendbar. Es setzt die weltweit vereinbarten Basel-III-Reformen um und umfasst Anpassungen der Eigenkapitalverordnung (Capital Requirements Regulation — CRR III) und der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive — CRD VI). Kernstück ist dabei die Einführung einer Eigenmittel-Untergrenze (Output Floor). Diese Untergrenze wurde mit 72,5 % festgelegt. Das heißt, der mittels bankinterner Modelle ermittelte Eigenkapitalbedarf darf im Vergleich zu den Standardansätzen maximal 27,5 % geringer sein. Im Zuge des Bankenpakets 2021 wurde auch das Thema ESG ausdrücklich im regulatorischen und aufsichtlichen Rahmenwerk verankert. Das betrifft Bereiche wie das Meldewesen, die Offenlegung, die Stresstests und den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess.
Ab 2025 ist die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA-Verordnung) vollständig anwendbar. Das wirkt sich auch auf den Finanzsektor und dessen Interaktion mit der Krypto-Industrie und den Krypto-Märkten aus. Banken benötigen keine MiCA-Lizenz, um Kryptowerte in der EU zu begeben. Soweit Banken vermögenswertreferenzierte Token oder E-Geld-Token ausgeben, sieht das MiCA-Verordnung-Vollzugsgesetz analog zur Bankenaufsicht eine gesetzliche Aufgabenteilung zwischen OeNB und FMA vor. Emissionen von Kryptowerten durch österreichische Banken sind aktuell noch selten. Die geringe Dynamik könnte auch auf aktuelle Graubereiche des Regulariums zurückzuführen sein.
Die Europäische Kommission führte 2024 eine Konsultation zu makroprudenziellen Maßnahmen für Nichtbanken-Finanzintermediation (NBFI) durch. Ziel ist eine europaweite Anpassung des makroprudenziellen Rahmens. Die OeNB und die FMA nahmen an dieser Konsultation teil. Obwohl derzeit keine systemischen Risiken von NBFI in Österreich ausgehen, sollte aufgrund der wachsenden Bedeutung dieser Institute die Überwachung verstärkt werden. Dafür ist es notwendig, die Datenverfügbarkeit zu verbessern.
OeNB etabliert eine umfassende Data Governance
Die OeNB hat 2024 ein Data-Governance-Konzept erarbeitet, dessen zentrales Element neben der Einführung von Data-Governance-Rollen ein neuer Datenkatalog zur Dokumentation und raschen Auffindbarkeit aller relevanten Daten der OeNB ist. Die Data Governance bietet mittels Standards und Richtlinien den Rahmen für einen effizienten und transparenten Umgang mit Daten in der OeNB. Ein neu geschaffenes Data Office unterstützt künftig die Organisation in allen Fragen der Data Governance.
Start der neuen Daten- und Analyseplattform
Im September 2024 startete eine neue OeNB-interne Daten- und Analyseplattform mit einem zentralen Data Lake, d. h. einem großen Speicher für strukturierte und unstrukturierte Daten. Dadurch werden wesentliche Herausforderungen des heutigen Datenmanagements adressiert: Geeignete Werkzeuge und künstliche Intelligenz sollen genutzt werden, um das rasante Datenwachstum, aber auch die steigenden und komplexeren Anforderungen zu bewältigen.
Plattform „Sparzinsen Österreich“ mit großer Nachfrage
Am 6. Dezember 2023 präsentierte die OeNB die Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen der Öffentlichkeit. Diese informiert über die von österreichischen Banken gebotenen Sparzinsen auf Einlagen. Die Initiative für dieses Projekt erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Banken und der Wirtschaftskammer Österreich. Im Jahr 2024 wurden rund 115.000 Zugriffe registriert, wobei das Interesse rund um den Weltspartag besonders hoch war.
Neuer „Research Desk“ unterstützt Wirtschaftsforschung
Die OeNB erweitert ihr breites Datenangebot um einen „ Research Desk “, der ein stetig wachsendes Spektrum an granularen Daten zur Verfügung stellt und v. a. an Universitäten und Forschungsinstitute gerichtet ist. Damit leistet die OeNB einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftsforschung in Österreich. Auf internationaler Ebene wird der Research Desk künftig intensiv mit vergleichbaren europäischen Einrichtungen vernetzt sein, insbesondere mit jenen im Euroraum.
Entwicklung eines statistischen internen Bonitätsanalyseverfahrens
Zur Beurteilung der Bonität nichtfinanzieller Unternehmen digitalisiert und erfasst die OeNB deren Jahresabschlüsse automatisiert. Gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank, einem langjährigen Partner auf diesem Gebiet, wird die Einführung einer rein statistischen Ratingplattform auf Basis des bestehenden internen Bonitätsanalyseverfahrens (in-house credit assessment system) geprüft.
Früherkennung von problematischen Entwicklungen von Banken
Seit 2023 beschäftigt sich die OeNB in der Statistik intensiv mit Anwendungsfällen für künstliche Intelligenz. Ein Vorhaben beschäftigt sich damit, Muster zu erkennen, die auf grobe Unstimmigkeiten bei einer Bank hindeuten können. Dazu werden zur Verfügung stehende Meldedaten mittels modernster Methoden des Machine Learning und der künstlichen Intelligenz verknüpft. Die mit diesen innovativen Verfahren des überwachten und unüberwachten Lernens erzielten Ergebnisse lassen erwarten, dass auf ihrer Grundlage das Monitoring von Banken weiter verbessert wird. Dadurch kann auch der OeNB-Datenschatz insgesamt effizienter und umfassender genützt werden.
2024 wurde ein insgesamt drei Jahre dauerndes Implementierungsprojekt gestartet, im Rahmen dessen eine geeignete technische Infrastruktur geschaffen wird. Mit dieser können dann diese Modelle kalibriert und für einen laufenden operativen Betrieb implementiert und betrieben werden.
Neue Wege im europäischen Meldewesen
Mit der Novellierung der EU-Eigenkapitalverordnung (CRR III) werden die Anforderungen an das aufsichtsrechtliche Meldewesen angepasst und teilweise deutlich erweitert. Dadurch soll u. a. auch die Überwachung der Kapitalquoten nach den neuen Regeln der CRR III ab 2025 gewährleistet und Datenanforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit entsprochen werden (siehe auch Abschnitt „Finalisierung der Basel-III-Reformagenda und weitere regulatorische Themen mit Relevanz für den österreichischen Finanzsektor“).
Parallel wird im ESZB ein einheitliches System zur Erhebung, Verarbeitung und Analyse von Daten im Euroraum namens IReF (Integrated Reporting Framework) entwickelt, um das statistische Meldewesen im Euroraum zu harmonisieren.
Um den Aufwand für meldende Institutionen und Regulatoren möglichst gering zu halten, wurde das Joint Bank Reporting Committee (JBRC) gegründet, das in Kooperation zwischen Regulatoren und Banken u. a. das Ziel verfolgt, Redundanzen im Meldewesen zu reduzieren und das Verständnis von neuen Anforderungen zu erhöhen. Expert:innen der OeNB wirken in verschiedenen zentralen Positionen (z. B. als Vorsitzende von Arbeitsgruppen) an diesen Weiterentwicklungen im europäischen Meldewesen mit.
Ausbau der Außenwirtschaftsstatistiken mit neuen Daten und
historischen Zeitreihen
Mit dem Statistikangebot STEC (Services Trade by Enterprise Characteristics) stellt die OeNB detaillierte Informationen über österreichische Unternehmen im internationalen Dienstleistungshandel zur Verfügung. Das offizielle Datenangebot der OeNB zur Außenwirtschaft Österreichs wird damit weiter ausgebaut. Die Daten fördern das Verständnis außenwirtschaftlicher Zusammenhänge und können Unternehmen dabei helfen, ihre wirtschaftliche Planung zu verbessern.
Im September 2024 wurden die historischen Zeitreihen der Außenwirtschaftsstatistiken und der Gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung (GFR) umfangreich überarbeitet (Außenwirtschaftsstatistik bis 2013 bzw. GFR bis 1995). Dies erfolgt koordiniert mit Eurostat und EZB alle fünf Jahre, betrifft auch die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und bietet den Nutzer:innen somit noch längere, konsistente und harmonisierte Zeitreihen.
Bargeld weiterhin modernes Zahlungsmittel
Bargeld bietet viele Vorteile, verbindet es doch Altbewährtes mit modernster Produktions- und Sicherheitstechnologie. Banknoten und Münzen sind einfach zu nutzen, sicher und für alle zugänglich. Darüber hinaus ist Bargeld stets unabhängig von externen Rahmenbedingungen verfügbar und wird in der Regel überall akzeptiert.
Bargeld steht für Unabhängigkeit und Wahlfreiheit. Es ist essenziell für die gesellschaftliche Teilhabe sowie das Vertrauen in das Finanzsystem. In Österreich bleibt Bargeld wichtig und für viele Menschen unverzichtbar, selbst in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft.
Es ist uns ein Anliegen, dass Bargeld weiterhin ein effizientes Zahlungsmittel auf höchstem technologischen Niveau bleibt. Daher engagieren wir uns in der OeNB auf nationaler und internationaler Ebene für alle Fragen rund um den Bargeldkreislauf oder die Produktion und Gestaltung von Euro-Banknoten.
Dass Bargeld ein zeitgemäßes Zahlungsmittel ist, bekräftigte jüngst eine Studie der EZB zur Nutzung von Bargeld durch Unternehmen im Jahr 2024 . So akzeptieren in Österreich 90 % der Unternehmen Bargeld als Zahlungsmittel. Das sind etwas mehr als der Euroraum-Durchschnitt von 88 %.
Strategische Zielsetzungen der OeNB im Bargeldbereich
Wir fördern und stärken die Akzeptanz von Bargeld und setzen uns für eine flächendeckende Bargeldversorgung und -infrastruktur ein. Daher begrüßen wir die 2024 getroffene Vereinbarung zwischen dem Österreichischen Gemeindebund und den Banken zur Sicherstellung der Bargeldversorgung in den Gemeinden. Dadurch wird v. a. die Bargeldversorgung im ländlichen Raum vorerst bis 2029 abgesichert.
Die OeNB und ihre Bargeld-Tochtergesellschaften schärfen das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung des Bargelds, um diskriminierungsfreies Bezahlen mit Bargeld zu ermöglichen (siehe auch Kapitel „Unsere Tochterunternehmen ergänzen den OeNB-Geschäftsbetrieb“). Wir setzen dabei auf verstärkte Kommunikation sowie Kooperation und Austausch mit unseren Partnern. Zudem unterstützen wir aktiv EU-weite Maßnahmen, um Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel zu sichern. Damit gewährleisten wir einen effizienten Bargeldkreislauf in Österreich.
Die OeNB stützt ihre Initiativen und Ziele im Bargeldbereich auf zahlreiche Studien und Analysen. 2024 untersuchten wir z. B. die Erreichbarkeit von Geldausgabegeräten in Österreich. Ziel war es zu ermitteln, ob sich seit 2021 die Entfernung zwischen der Wohnadresse und dem nächstgelegenen Geldausgabegerät verändert hat. Die Ergebnisse bestätigen, dass die österreichische Bevölkerung im europäischen Vergleich weiterhin gut mit Geldausgabegeräten versorgt ist. Dies spiegelt sich auch in der starken Bargeldnutzung in Österreich wider.
Bargeld bleibt laut neuer EZB-Studie führendes Zahlungsmittel im Euroraum
Bargeld war 2024 weiterhin das meistgenutzte Zahlungsmittel im Euroraum. Bargeld hält einen Anteil von 52 % an der Verkaufsstelle (am Point of Sale — POS). Das ergab eine neue EZB-Studie zu Zahlungsverhalten und Zahlungsmittelpräferenzen der privaten Haushalte im Euroraum, die Ende 2024 veröffentlicht wurde. 2022 wurden 59 % der Transaktionen bar bezahlt, 2019 waren es 72 %. Relevant für die Veränderung zwischen 2019 und 2022 waren insbesondere die Effekte der COVID-19-Pandemie, aber auch die zunehmende Digitalisierung. Dadurch erhöhte sich die Nutzung elektronischer Zahlungsmethoden.
Gleichzeitig wird die Bedeutung des Bargelds 2024 zunehmend als wichtiger wahrgenommen: Für 62 % der Befragten ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, mit Bargeld zahlen zu können. 2022 lag dieser Wert bei 60 %, 2019 bei 55 %.
Die zweithäufigste Zahlungsmethode im Euroraum sind Zahlungskarten. Ihr Anteil an POS-Zahlungen betrug 2024 39 % (2022: 34 %; 2019: 25 %). 2024 bevorzugten mehr als die Hälfte der Konsument:innen (55 %) die Karte am POS. 22 % zahlten lieber mit Bargeld und 23 % führten keine klare Präferenz an. Die Anteile blieben im Vergleich zu 2022 unverändert.
Zunehmender Beliebtheit im Euroraum erfreuen sich zudem Online-Zahlungen. Ihr Anteil ist 2024 auf 21 % gestiegen (2022: 17 %; 2019: 6 %). Damit werden inzwischen etwa ein Viertel aller Transaktionen (und mehr als ein Drittel des Volumens) online und nicht mehr vor Ort am POS durchgeführt.
In Österreich bleibt Bargeld weiterhin von zentraler Bedeutung (62 % der POS-Zahlungen). Damit bestätigt die aktuelle EZB-Studie auch die OeNB-Zahlungsmittelumfrage 2022/2023 . Letztere zeigte, dass 63 % der Befragten ihre Käufe bar zahlen. Bargeld macht weiters 56 % des Transaktionswerts aus (Steigerung um 4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022). Österreich belegt im Euroraum den dritten Platz bei der Anzahl der Bargeldtransaktionen und den zweiten Platz beim Transaktionswert. Nur Malta (67 %) und Slowenien (64 %) haben einen höheren Anteil an Barzahlungen am POS. In Litauen ist der Bargeldanteil am POS hinsichtlich des Transaktionswerts mit 59 % am höchsten.
Eine Möglichkeit der Barzahlung ist fast drei Viertel (73 %) der Befragten in Österreich wichtig oder sogar sehr wichtig. Das entspricht dem höchsten Wert im Euroraum, gefolgt von Deutschland (69 %) und Griechenland (68 %). Außerdem war Bargeld in Österreich 2024 mit 38 % weiterhin fast doppelt so beliebt wie im Euroraum-Durchschnitt von 22 %.
Zahlungskarten sind die zweitmeist genutzte Zahlungsmethode in Österreich. Ihr Anteil an POS-Zahlungen belief sich 2024 auf 31 % (2022: 25 %, 2019: 19 %). Sie sind 2024 am POS mit 39 % erstmals leicht beliebter als Bargeld (38 %). Gleichzeitig wächst in Österreich die Vorliebe für elektronische Bezahlmethoden, v. a. für Online-Zahlungen.
Online-Zahlungen machten in Österreich 2024 28 % aller alltäglichen Zahlungen aus. Das entspricht einer Steigerung von 17 Prozentpunkten gegenüber 2019.
Zusammenfassend zeigt die aktuelle EZB-Studie: Bargeld spielt in Österreich weiterhin eine wichtige Rolle und wird von Konsument:innen als zentraler Bestandteil ihrer Zahlungsgewohnheiten geschätzt.
Die künftigen Euro-Banknoten nehmen Form an
Der EZB-Rat traf Ende Jänner 2025 eine Vorauswahl der Motive für die künftigen Euro-Banknoten. Diese basiert auf den Vorschlägen einer interdisziplinären Berater:innengruppe und spiegelt die Präferenzen von über 365.000 Europäer:innen wider, die in Fokusgruppen zwischen Dezember 2021 und März 2022 sowie in öffentlichen Umfragen im Sommer 2023 geäußert wurden. Auf dieser Grundlage wurden zwei mögliche Themen festgelegt: „Europäische Kultur: Gemeinsame Kulturstätten“ und „Flüsse und Vögel: Stark durch Vielfalt“. Das Thema „Europäische Kultur“ sieht für die Vorderseite der Banknoten herausragende europäische Persönlichkeiten vor. So wäre geplant, auf der Vorderseite der 200-Euro-Banknote eine Österreicherin abzubilden: Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin. Dies würde ein starkes Zeichen für den Frieden und die bedeutende Rolle der Frauen in Europa setzen.
Nach einem Designwettbewerb 2025 wird die EZB 2026 die Öffentlichkeit befragen, welche Entwürfe sie bevorzugt. Anschließend wird der EZB-Rat final über die Designs entscheiden und den Zeitpunkt für die Ausgabe der neuen Euro-Banknoten festlegen.
Wie laufen die Vorbereitungen für den digitalen Euro?
Ein digitaler Euro wäre das erste digitale gesetzliche Zahlungsmittel für den gesamten Euroraum. Somit wäre er das digitale Gegenstück zum Euro-Bargeld und würde die bestehende Zahlungslandschaft um digitales Zentralbankgeld ergänzen. Der digitale Euro ermöglicht Europa strategische Autonomie gegenüber nicht europäischen Zahlungssystemen und privaten Kryptowährungen mit Zahlungsfunktion (wie
z. B. Stablecoins).
Die OeNB und die anderen nationalen Zentralbanken des Eurosystems arbeiten mit der EZB am digitalen Euro. Erst wenn der Rechtsrahmen dafür feststeht, wird das Eurosystem eine Entscheidung über die Ausgabe eines digitalen Euro treffen.
Mehr Auswahl, Privatsphäre und Inklusion für Bürger:innen
Mit dem digitalen Euro hätten die Bürger:innen beim elektronischen Bezahlen eine zusätzliche digitale Zahlungsoption und somit mehr Wahlfreiheit. Sie könnten damit überall im Euroraum jederzeit bequem, sicher und kostengünstig elektronisch bezahlen: ob nun im regionalen Lebensmittelgeschäft, beim internationalen Online-Händler oder bei Zahlungen zwischen privaten Nutzer:innen. Es soll eine Online- und eine Offline-Bezahlfunktion geben. Vor allem die Offline-Funktion soll Bargeld-Zahlungen möglichst nahekommen. Dabei sollen hohe Datenschutz-Standards die Privatsphäre der Nutzer:innen bestmöglich schützen.
Auch der Handel könnte vom digitalen Euro profitieren: Er bekäme damit eine zusätzliche kostengünstige Bezahlfunktion, die allen Kund:innen offen steht und euroraumweit nutzbar ist. Letzteres wäre neu, denn derzeit gibt es nur national bzw. regional nutzbare Zahlungslösungen. Ein weiterer Vorteil: Das Eurosystem wird keine Gebühren für Zahlungen mit dem digitalen Euro verrechnen. Daher würden sich die Kosten für den Handel reduzieren, die Zahlungsabwicklung beschleunigen und die Effizienz erhöhen.
Zahlungsdienstleister wie Banken und Fintechs würden — ähnlich wie bei Bargeld — eine wichtige Rolle bei der Verteilung des digitalen Euro spielen. Zudem erhielten sie damit eine europäische Plattform, um innovative euroraumweit verfügbare Zusatzdienstleistungen zu entwickeln. Damit könnten sie neue Kund:innengruppen gewinnen und attraktive Geschäftsmodelle ausarbeiten — wie etwa Mehrwert-Services und Kund:innenbindungs-Programme. Für ihre Leistungen bekämen die Zahlungsdienstleister eine faire Abgeltung.
Damit der digitale Euro im Alltag funktioniert, ist es wichtig, die Bedürfnisse und Anforderungen der Bürger:innen, des Handels und der Zahlungsdienstleister zu kennen. Deshalb tauscht sich die OeNB regelmäßig mit den Interessenvertreter:innen dieser drei Gruppen aus. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bedürfnisse vulnerabler Bevölkerungsgruppen und auf Menschen mit Einschränkungen gelegt, um deren finanzielle Inklusion zu gewährleisten.
Mehr Innovation, Wettbewerb und Autonomie für den europäischen Binnenmarkt
Mit dem digitalen Euro würde Europa neue Standards für digitales Bezahlen setzen. Konsument:innen könnten mit ihm im digitalen Raum mit elektronischem Zentralbankgeld bezahlen. Der digitale Euro könnte die Effizienz der europäischen Zahlungsverkehrslandschaft wesentlich steigern und Innovationen fördern. Er würde der derzeit starken Fragmentierung entgegenwirken und könnte die Abhängigkeit von außereuropäischen Zahlungsdienstleistern reduzieren. Damit würde das europäische Zahlungsverkehrssystem widerstandsfähiger, sicherer und stabiler. Dies käme dem europäischen digitalen Binnenmarkt zugute, es würde die geopolitische Unabhängigkeit Europas stärken und damit auch die strategische Autonomie des europäischen Finanzsektors.
EU und Zentralbanken arbeiten am gesetzlichen und technischen Rahmen
Bevor der digitale Euro Wirklichkeit werden kann, bedarf es gesetzlicher und technischer Voraussetzungen. Über die gesetzlichen Grundlagen entscheiden auf Basis des Gesetzesvorschlags der Europäischen Kommission die beiden Ko-Gesetzgeber — also der Rat und das Europäische Parlament. Gleichzeitig beschäftigen sich EZB und Eurosystem mit der technischen Umsetzung.
Auswirkungen des digitalen Euro auf die Finanzmarktstabilität
In einer Auswirkungsanalyse untersuchte die OeNB mögliche Risiken der Einführung des digitalen Euro für die Finanzmarktstabilität. Untersucht wurden insbesondere die Auswirkungen der Substitution von Einlagen bei Banken durch Guthaben in digitalen Euro sowie die Auswirkungen auf Liquiditätsausstattung, Erträge und Kosten von Banken. Die Studie zeigt, dass die Effekte je nach Geschäftsmodell der Banken sehr unterschiedlich ausfallen können. Systemische Risiken für die Finanzmarktstabilität könnten sich nur bei sehr hohen Bestandslimits des digitalen Euro und in bestimmten krisenhaften Situationen ergeben. Aus Sicht der Finanzmarktstabilität sollte daher die Zahlungsfunktion (im Gegensatz zur Wertaufbewahrungsfunktion) des digitalen Euro im Zentrum stehen. Bei umsichtiger Ausgestaltung, insbesondere des Bestandslimits, kann das Risiko für die Finanzmarktstabilität stark reduziert werden. Das Eurosystem hat daher bei der Ausgestaltung des digitalen Euro die Finanzmarktstabilität im Blick.
OeNB setzt sich in allen Bereichen für
Nachhaltigkeit ein
Die OeNB berücksichtigt in ihren Aktivitäten so weit wie möglich die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Damit wollen wir eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung fördern.
Nachhaltigkeit wird im Sinne des Brundtland-Berichts der Vereinten Nationen von 1987 definiert als „Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr breit gefächert. Verschiedene Bereiche der OeNB übernehmen Verantwortung für ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusste Unternehmensführung, d. h. die sogenannten ESG-Bereiche. 2024 fassten wir die diesbezüglichen Unternehmensschwerpunkte wie z. B. die Umweltpolitik und die Gleichbehandlung zu einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie zusammen. Die OeNB bekennt sich in ihrem Leitbild klar zur Nachhaltigkeit.
Ökologische Nachhaltigkeit — neue Initiativen und erreichte Meilensteine
In der OeNB betreiben wir seit mehr als 25 Jahren unser Umweltmanagement gemäß den Vorgaben des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Es gelang uns, in diesem Zeitraum den Energieverbrauch um mehr als 30 % und den Papierverbrauch um mehr als 90 % zu reduzieren.
2024 begann die Montage von Photovoltaik-Anlagen an den drei Gebäuden des OeNB-Hauptsitzes in Wien — ein weiterer Meilenstein unseres Projekts „Urban Heating — klimafitte OeNB“. Wir werden den gewonnenen Strom direkt für den eigenen Strombedarf nutzen. Daneben werden wir weiter zertifizierten Ökostrom beziehen und die thermische Sanierung unserer Gebäude vorantreiben.
Auch die Töchterbetriebe in der OeNB-Unternehmensgruppe setzten zahlreiche Umweltschutz-Maßnahmen. Hervorzuheben sind: (a) die Vorbereitungen für umfassende Nachhaltigkeitsberichte, (b) die Photovoltaik-Projekte für die GSA-Gebäude, die gemeinsam mit der BLM/IG Immobilien realisiert werden, und (c) die langjährigen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen der OEBS im Rahmen ihres EMAS-Umweltmanagements.
Weiters setzten wir 2024 folgende Maßnahmen um: Wir erneuerten die Lüftungszentrale des Hauptgebäudes, schlossen unsere Zweigstelle in Innsbruck an die Fernwärme an und erweiterten die LED-Beleuchtung in einem unserer Wiener Bürogebäude. Außerdem bezogen wir alle Fachbereiche zur Treibhausgasreduktion und Nachhaltigkeitsberichterstattung ein. Im Einkauf ergänzten wir die Palette umweltfreundlicher Produkte. Zusätzlich verlängerten wir den Einsatz von Dienstfahrrädern mit Elektroantrieb. Zur Verbesserung des Mikroklimas und als kleiner Beitrag zur Biodiversität im Stadtgebiet pflanzten wir ein paar Bäume auf dem Platz vor dem OeNB-Hauptgebäude.
Abseits von der Betriebsökologie fördern wir einige umweltrelevante Projekte. Der Mix reicht von Moor-Renaturierungen über eine Podcast-Reihe zu nachhaltiger Finanzierung bis hin zu Forschungsprojekten betreffend Auswirkungen nachhaltiger Investitionen und Grundlagenforschung zur Klimamodellierung.
EMAS-Umwelterklärung erscheint ab 2025 als separate Publikation
Die Umwelterklärung der OeNB war in den letzten Jahren Teil des Geschäftsberichts. Ab 2025 ist die EMAS-Umwelterklärung wieder als eigene Publikation auf der OeNB-Website verfügbar.
Green Finance: wie sich die OeNB mit Umwelt und Klima im Finanzwesen befasst
Das Reservemanagement der OeNB veröffentlicht einen Bericht über die Nachhaltigkeit der OeNB-Investitionen — nach einem im Eurosystem abgestimmten Verfahren.
In der Bankenaufsicht begleitet die OeNB die Entwicklung neuer Vorgaben zur stärkeren Berücksichtigung von Risiken in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (kurz ESG-Risiken). Ein Beispiel sind die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zum Management von ESG-Risiken. Im Rahmen der europäischen Bankenaufsicht und auf nationaler Ebene wird außerdem überprüft, dass Banken Nachhaltigkeitsrisiken adäquat berücksichtigen.
Die Statistik fokussierte 2024 u. a. auf die Bewertung von Sicherheiten im Zusammenhang mit geldpolitischen Geschäften. Dabei ging es darum, eine Methodik zur Berücksichtigung von physischen und Transitionsrisiken umzusetzen. Darüber hinaus wurde zur Überbrückung von Datenlücken ein Ad-hoc-Meldewesen auf europäischer und nationaler Ebene eingerichtet. Weiters wurde auf europäischer Ebene die Weiterentwicklung ESG-bezogener Indikatoren und künftiger Meldeinhalte vorangetrieben. Besonders hervorzuheben ist die erstmalige Beteiligung an der Validierung der klimabezogenen Indikatoren der EZB. Dies verbesserte die Qualität der nationalen Indikatoren und führte zu einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden Methodik.
Der Fachbereich Volkswirtschaft setzte seine Dialogreihe zur Energiewende mit namhaften Expert:innen vor einem breiten Publikum fort. Die erste Staffel mit neun Veranstaltungen zu technologischen Aspekten wie der Rolle von Erdgas, E-Fuels, Wasserstoff oder Kernenergie wurde mit einem Bericht abgeschlossen. Seit Mitte 2024 befasst sich eine zweite Veranstaltungsstaffel mit ökonomischen Überlegungen zur Energiewende. Behandelte Themen: Klimaszenarien, Abhängigkeit von China, CO2-Bepreisung oder Förderung grüner Innovationen. Schließlich ist eine ökonomisch verträgliche Klimapolitik ganz im Sinne der Preis- und Finanzmarktstabilität — des Kernmandats der OeNB.
Darüber hinaus beschäftigten sich Publikationen der OeNB mit dem optimalen CO2-Preis zur Erreichung der EU-Klimaziele, den Inflationseffekten der österreichischen CO2-Bepreisung, den Verteilungswirkungen finanzmarktorientierter und fiskalischer Umweltpolitik sowie der Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Green Finance. Der Fachbereich organisierte auch einen Kurs über Green Finance für internationale Regulierungsbehörden und Zentralbanken sowie Vorträge eines Netzwerks von Klimaökonom:innen, u. a. im Rahmen der Nationalökonomischen Gesellschaft. Intern betreut der Bereich den regelmäßigen OeNB-weiten Informationsaustausch im Rahmen einer Green-Finance-Plattform und die dazugehörige Themenwebsite.
Im internen Risikomanagement wurde die Integration von ESG-Risiken in das Risikorahmenwerk weiter vorangetrieben. Die interne Berichterstattung umfasst Indikatoren zu Transitions- und physischen Risiken. Daneben wurden erste Analysen zu Abhängigkeiten von Ökosystemleistungen erstellt, d. h. Leistungen der Natur, die dem Wohl der Menschen dienen.
Ein Klimastresstest für das nicht geldpolitische Portfolio wurde auch im Jahr 2024 durchgeführt. Ziel war es zu simulieren, wie sich wichtige Risikokennzahlen und Verlustpotenziale anhand von zwei Negativszenarien gegenüber einem Basisszenario entwickeln. Damit wurden die unmittelbaren und direkten betriebswirtschaftlichen Konsequenzen für die OeNB geschätzt. Die ausgewählten Szenarien basieren auf Szenarien des Network for Greening the Financial System (NGFS), eines freiwilligen Zusammenschlusses von Notenbanken und Aufsichtsorganen.
In NGFS-Arbeitsgruppen arbeitet die OeNB an Empfehlungen und Best Practices für das Management von Risiken und verantwortungsvolles Investieren mit. Gleichzeitig profitiert die OeNB vom intensiven Wissensaustauch mit anderen Notenbanken.
Impulse für eine starke Unternehmenskultur und zukunftsfähige Entwicklungen im Personalwesen
2024 setzten wir neue Impulse und Maßnahmen, um die OeNB als attraktive Arbeitgeberin zu stärken. Mit einer klaren Strategie und innovativen Ansätzen erzielten wir in den Bereichen Mitarbeiter:innenbindung, Gesundheitsmanagement, Kompetenzentwicklung und Gleichbehandlung wertvolle Fortschritte.
Mitarbeiter:innenbindung ist das neue Recruiting
| Teilzeit-Anteil in % | 23,2 |
|---|---|
| Homeoffice-Tage pro Mitarbeiter:in im Jahr | 67,9 |
| Sabbaticals | 20 |
|
Aus- und Weiterbildungs-Tage
pro Mitarbeiter:in im Jahr |
5,5 |
| Mobilitätsrate in %1 | 8,3 |
| Fluktuationsrate in % | 2,8 |
| Quelle: OeNB. | |
|
1 Anteil der Mitarbeiter:innen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit entweder einen zeitlich
befristeten Arbeitseinsatz bei nationalen oder internationalen Organisationen absolviert oder an internen Jobrotationen teilgenommen haben. Dies umfasst auch die Teilnahme an Vor-Ort-Prüfungen durch länderübergreifende Teams im Rahmen der europäischen Bankenaufsicht. |
|
Als Zentralbank der Republik Österreich bieten wir unseren Mitarbeiter:innen nicht nur interessante Aufgaben, sondern auch attraktive Rahmenbedingungen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns besonders wichtig. Dies macht sich u. a. durch eine geringe Fluktuationsrate von 2,8 % bezahlt (Tabelle 1). Dennoch setzen wir regelmäßig neue Impulse: Denn für eine Expert:innenorganisation ist die Bindung bestehender Mitarbeiter:innen, wofür auch der englische Ausdruck „retention“ geläufig ist, entscheidender denn je. Unter dem Motto „Retention ist das neue Recruiting“ ergriffen wir verschiedene Maßnahmen, um unsere Talente langfristig zu halten und die Verbundenheit zum Unternehmen zu steigern.
Ein Highlight im Zusammenhang mit unserem Employer Branding waren interne Foto- und Videodreh-Aktionen für einen modernen und authentischen Außenauftritt der OeNB. Letzterer ist im Recruiting essenziell, um sich von anderen Arbeitgebern abzuheben und das Interesse von Bewerber:innen zu wecken.
Zusätzlich wurde unser Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter:innen erweitert. Das soll über die Recruiting-Phase hinaus den Kontakt zwischen neuen Mitarbeiter:innen und ihren Partner:innen im Personalwesen fördern. So soll künftig nach einigen Monaten Feedback über das laufende Onboarding eingeholt werden.
Unsere Position als attraktive Arbeitgeberin stärken wir auch durch die Teilnahme am Audit
„berufundfamilie“. Die daraus resultierenden Maßnahmen tragen dazu bei, die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen zu erhöhen. Im Berichtsjahr endete wieder eine dreijährige Auditperiode, in deren Rahmen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt wurden: z. B. die Unterstützung hybrider Arbeitsformen und virtueller Führung, ein Mentoring-Programm oder Verbesserungen bei der Väterkarenz. Die OeNB wurde Ende 2024 erfolgreich rezertifiziert. Damit erhalten wir für die kommenden drei Jahre wieder das Zertifikat „berufundfamilie“ durch das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien. Erstmalig legten wir die Schwerpunkte für die neue Auditperiode durch einen Ideenwettbewerb fest, wobei alle Mitarbeiter:innen teilnehmen und abstimmen konnten.
Gesundheitsmanagement als Schlüssel zur langfristigen Leistungsfähigkeit
Gesundheit ist mehr denn je ein zentraler Erfolgsfaktor — sowohl für die individuelle Leistungsfähigkeit als auch für das Unternehmen als Ganzes. Ein aktives Gesundheitsmanagement ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Hinblick auf die Mitarbeiter:innenbindung.
Unsere bestehenden Gesundheitsangebote wurden 2024 noch erweitert, wobei unser Fokus auf dem Thema Burnout-Prävention lag. Unter dem Motto „Weil ich es mir wert bin!“ wurde ein informativer Gesundheitstag veranstaltet. Zusätzlich wurden über unser Gesundheitszentrum zahlreiche Impfaktionen angeboten.
Fokus auf Kompetenzentwicklung: künstliche Intelligenz im Mittelpunkt
Die zunehmende Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) stellen neue Herausforderungen für Arbeitswelt und Mitarbeiter:innen dar und erfordern kontinuierliches Lernen. Um unsere Mitarbeiter:innen bestmöglich für diese Herausforderungen zu wappnen, erweiterten wir unser bereits sehr umfangreiches Trainingsangebot um den Schwerpunkt KI. Mit Trainingsformaten für Präsenz- und Online-Kurse stellten wir auf verschiedene Zielgruppen ab. Knapp ein Viertel aller OeNB-Mitarbeiter:innen hat zumindest eines dieser Angebote genutzt.
Allgemein wird das umfangreiche Trainingsangebot von unseren Mitarbeiter:innen stark in Anspruch genommen: So verzeichneten wir 2024 pro Mitarbeiter:in durchschnittlich 5,5 absolvierte Aus- und Weiterbildungstage.
Zehn Jahre Umsetzung des Gleichbehandlungsgesetzes in der OeNB — ein Rückblick
2024 wurde ein bedeutendes Jubiläum gefeiert: Die OeNB unterliegt seit zehn Jahren dem Bundesgleichbehandlungsgesetz. Ein umfangreiches Programm mit 19 Veranstaltungen unterstrich im Jubiläumsjahr das Engagement der OeNB für Gleichbehandlung und Vielfalt .
| % | |
|---|---|
| Fachkarriere gesamt | 38,7 |
| Führungskarriere gesamt | 28,4 |
| davon: | |
| Gruppenleiter:in | 23,6 |
| Stellvertretende:r Abteilungsleiter:in | 29,7 |
| Abteilungsleiter:in | 33,3 |
| Direktor:in der Hauptabteilung | 30,0 |
| Quelle: OeNB. | |
In der OeNB liegt der Frauenanteil bei rund 39 % der Belegschaft. Tabelle 2 zeigt den jeweiligen Frauenanteil in der Fach- und Führungskarriere im Jahr 2024.
Wichtige Maßnahmen für eine inklusive und gleichberechtigte Arbeitswelt wurden nicht nur vom Team der OeNB-Gleichbehandlungsbeauftragten umgesetzt, sondern auch von zwei Mitarbeiter:innen-Netzwerken (OeNB Women’s Forum und OeNBunt).
Besondere Höhepunkte: Bei einer Veranstaltung des OeNB Women’s Forum zum Thema „Board Diversity“ standen die ökonomischen Vorteile diverser Führungsgremien im Vordergrund. In der Sonderausstellung „OeNB-Heldinnen“ wurde die Rolle der Frauen in der OeNB in ihrer über 200-jährigen Geschichte gezeigt. Im Mai stand der „Tag der Vielfalt“ im Mittelpunkt, hier waren alle Mitarbeiter:innen eingeladen, sich einen Tag lang mit den verschiedenen Facetten von Diversität auseinanderzusetzen. Im September fand das neunte ESZB- und SSM-Treffen zu „Diversity and Inclusion“ in der OeNB statt und im November wurde der Forschungspreis von „Pride Biz Austria“ in der OeNB verliehen. Zum ersten Mal wurde dafür auch ein Preis von der OeNB gestiftet — für eine Forschungsarbeit, die sich mit der Stigmatisierung von LGBTIQ+-Mitarbeiter:innen und den positiven Effekten von sozialer Unterstützung in der Arbeitswelt beschäftigt.
Neue Schwerpunkte im Bereich Compliance und Governance
2024 wurde das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erlassen, das überwiegend mit 1. September 2025 in Kraft treten wird. Für die OeNB ist das IFG in zweierlei Hinsicht relevant, nämlich bei der Ausübung hoheitlicher Behördenfunktionen und abseits davon als Unternehmen im staatlichen Alleineigentum, das vom Rechnungshof kontrolliert wird. Im Frühjahr 2024 wurde ein Projekt zur Umsetzung des IFG in der OeNB gestartet. In Anlehnung an bestehende Auskunftsprozesse geht es dabei auch um Folgendes: die Erstellung von Informationsmaterial für die Belegschaft, Ausbildungs-Initiativen und Bewusstseinsbildung, die Bereitstellung von Prozessgrafiken sowie IT-Unterstützung durch Auswahl geeigneter Instrumente für die Abwicklung, fristgerechte Beantwortung und Dokumentation aller Auskunftsanfragen an die OeNB.
2024 war OeNB-Schwerpunktjahr zum Thema künstliche Intelligenz
Schon seit einigen Jahren wird in der OeNB fachspezifische Expertise zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen aufgebaut. Die jüngsten bahnbrechenden, breitenwirksamen Weiterentwicklungen in diesem Bereich wurden 2024 zum Anlass genommen, die OeNB als Unternehmen fit für KI zu machen und einen ganzheitlichen Zugang zu entwickeln.
Den Kern des Schwerpunktjahres bildete ein multidisziplinäres Projekt, in dem wir die Potenziale von KI in der OeNB und alle zu adressierenden Rahmenbedingungen identifizierten. Anhand vielfältiger Anwendungsideen wurden repräsentative Prototypen für unterschiedliche Geschäftsbereiche entwickelt und erste KI-Anwendungen in Betrieb genommen. Wir unterzogen die technischen Neuerungen und deren Auswirkungen zudem einer fundierten rechtlichen Beurteilung, und es wurde ein adäquater Regelungsrahmen unter besonderer Berücksichtigung von Compliance und Ethik entwickelt.
Um einen breitflächigen Know-how-Aufbau zu gewährleisten, etablierten wir ein KI-Ausbildungsprogramm, das unterschiedliche Bedürfnisse je nach benötigter Vertiefung berücksichtigt. Die Palette umfasst Grundlagenschulungen für Anwender:innen bis hin zu spezifischen Ausbildungen für Entwickler:innen und Data Scientists. Flankiert wurde das KI-Projekt von laufenden niederschwelligen Kommunikationsmaßnahmen sowie einem Informationsaustausch auf internationaler Ebene. Letztendlich ist es uns mit dem Schwerpunktjahr gelungen, die OeNB strukturiert und zukunftsorientiert für die Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit KI aufzustellen.
Cybersicherheit und Cyberresilienz schützen vor erhöhten Risiken
Im Bereich der Informationssicherheit wurde in der OeNB bereits 2023 die Funktion eines Enterprise Chief Information Security Officer (E-CISO) für die OeNB-Unternehmensgruppe eingerichtet. Der E-CISO soll in der OeNB und den Tochtergesellschaften die Governance für Informationssicherheit stärken. Weiters soll er in strategischen Angelegenheiten zu diesem Thema ein von der jeweiligen internen IT unabhängiges „zweites Augenpaar“ darstellen. Die Informationssicherheits-Verantwortlichen der Einzelunternehmen entwickeln also mit dem E-CISO die Informationssicherheits-Strategie weiter. Ein Fokus ist dabei die Mitarbeit an der Umsetzung der Anforderungen des Eurosystems, denen Finanzmarkt-Infrastrukturen in puncto Cyberresilienz entsprechen sollen (cyber resilience oversight expectations — CROE).
2024 erstellte der E-CISO eine gemeinsame Strategie für Informationssicherheit für die OeNB und ihre Tochterunternehmen auf Basis der OeNB-Strategie und brachte sie zur Anwendung. Für die strategische Entwicklung der Informationssicherheit wurde ein gemeinsamer Prozess geschaffen (cyber risk strategy process — CRISP). Im Rahmen dieses Prozesses wurden Umfeldanalysen und Risikoanalysen durchgeführt sowie Entwicklungspotenziale definiert. Zwei wesentliche Bedrohungsanalysen waren im Fokus: Cyberangriffe mit KI-Unterstützung („weaponized artificial intelligence“) und Bedrohungen durch Quantencomputer („post quantum computing“). 2025 werden wir schwerpunktmäßig internationale Informationssicherheits-Standards analysieren und auf der Ebene der Unternehmensgruppe den Jahreszyklus weiterentwickeln, nach dem die Aufgaben der Informationssicherheit systematisch durchgeführt werden.
Nun zum aktuellen Status der Informationssicherheit in der OeNB: Mit ihrem Informationssicherheits-Programm bis 2025 hat die OeNB eine solide Basis geschaffen und das strategische Unternehmensziel erreicht. Für den Zeitraum bis 2030 wird ein neues Programm zur Cybersicherheit und Cyberresilienz initiiert. Es soll uns dabei unterstützen, in den nächsten Jahren das höchste Niveau der CROE-Anforderungen zu erreichen. Ziel ist es, die OeNB langfristig auf sicherheitsrelevante Bedrohungen vorzubereiten.
Welche Risiken bedrohen aktuell die Cybersicherheit? Aufgrund des andauernden Krieges zwischen Russland und der Ukraine sind weiterhin vermehrt Cyberangriffe zwischen den beteiligten Staaten sowie deren jeweiligen Hacker-Gruppen zu verzeichnen. Diese Situation beeinflusst auch die Europäische Union, da politische Sanktionen, Aktivitäten und Äußerungen von EU-Ländern Angriffe auf Institutionen innerhalb der EU nach sich ziehen. Diese manifestieren sich häufig als Überlastungsangriffe (Distributed-Denial-of-Service- oder kurz DDoS-Angriffe) oder als gezielte Abhörversuche. Auch die OeNB beobachtet eine Zunahme von DDoS-Attacken und vermehrtes aktives Scannen der IT-Infrastruktur, um mögliche Schwachstellen auszunutzen. Die Sicherheitsmaßnahmen der OeNB werden laufend verstärkt, um die Stabilität unserer Systeme weiterhin gewährleisten zu können.
Finanzbildung: neue Angebote und Forschungsergebnisse
2024 haben wir das Finanzbildungsangebot weiter ausgebaut und auch in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern neue Zielgruppen erschlossen. Mit neuen Forschungsergebnissen zur Finanzbildung schaffen wir die Basis für eine fundierte Weiterentwicklung der Finanzbildung in Österreich.
Ausbau der Bildungsangebote für jüngere Kinder und Pädagog:innen
In Österreich gibt es noch kaum Finanzbildungsangebote für den Elementarbereich. Im Pilotprojekt „Geldwert — Wertvoll“ erprobten und evaluierten wir daher ein Jahr lang Materialien zum Thema Finanz-, Verbraucher:innen- und Wertebildung in Kindergärten. Das Bildungsangebot wird nun auf Basis der Evaluationsergebnisse weiterentwickelt. Auch das Angebot für Kinder im schulpflichtigen Alter und Pädagog:innen konnten wir weiter ausbauen: Mit der neuen — durch ein Gütesiegel des Bildungsministeriums ausgezeichneten – Lern- und Sparziel-App „Meiki“ erlernen Neun- bis Zwölfjährige spielerisch wirtschaftliche Kompetenzen. Im Rahmen unseres Engagements in der Stiftung für Wirtschaftsbildung wurde außerdem das zweite von insgesamt vier Pilotjahren zur Erprobung vertiefender Wirtschaftsbildung in der Sekundarstufe I abgeschlossen. Zielgruppe sind hier also Schüler:innen der fünften bis achten Schulstufe.
Neue digitale Bildungsangebote für breite Zielgruppen
Als erste Anlaufstelle zu Finanzthemen dient seit 2024 das Onlineportal Finanznavi . Dieses entwickelten wir in der OeNB im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie mit dem Bundesministerium für Finanzen. Neben dem Finanznavi bieten wir mit dem Relaunch der OeNB-Finanzbildungs-Website nun einen noch einfacheren Zugang zu allen OeNB-Finanzbildungsangeboten. Auf der Website haben wir mit FinCity Adventures zusätzlich eine neue virtuelle Lernwelt zu den Themenbereichen Inflation und Kapitalmarkt geschaffen. Sie kann sowohl im Unterricht als auch zum individuellen Lernen genutzt werden. Um Finanzbildung barrierefreier zu gestalten, bieten wir nun auch ausgewählte Finanzbildungsvideos in Gebärdensprache an.
Neue Erkenntnisse durch Forschung und Evaluation
2024 geben wir in Kooperation mit dem MCI Die Unternehmerische Hochschule im ersten Monitoringbericht der Nationalen Finanzbildungsstrategie erstmals einen Überblick über Inhalte, Vermittlungsmethoden, Zielgruppen und Anzahl der erreichten Personen der mehr als 130 Aktivitäten und Initiativen. Mit der OECD/INFE-Befragung über das Finanzbildungsniveau der Erwachsenen in Österreich konnten wir zeigen, dass die österreichische Bevölkerung im internationalen Vergleich einen hohen Finanzbildungsgrad hat.
Potenziale bieten zielgruppenorientierte Maßnahmen, etwa um den Gendergap in der jungen Bevölkerung zu schließen und die Langfristorientierung bei finanziellen Fragen zu stärken. Wir sehen außerdem, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Aufgabenerfüllung der OeNB 2024 gestärkt wurde. Um Forscher:innen, Entscheidungsträger:innen und Pädagog:innen über den aktuellen Stand der Forschung zu Finanzbildung zu informieren, haben wir die OeNB Financial Literacy Evaluation Series initiiert. Die Reihe behandelt theoretische, praxisorientierte und methodische Aspekte und soll neue Forschung und Evaluation zu Finanzbildung anregen und unterstützen.
„Sicher mit dem Euro.“ — erfolgreiche Infokampagne wurde fortgesetzt
Der Euro begleitet uns seit über zwei Jahrzehnten bei allen Zahlungsvorgängen. Ob im Geschäft, im Internet, zwischen Privatpersonen oder im Ausland — immer gilt: „Sicher mit dem Euro.“ Die gleichnamige Infokampagne 2024 wurde von Juli bis September intensiv über die Social-Media-Kanäle der OeNB, auf der OeNB-Website, auf Werbemedien im öffentlichen Raum sowie in Printmedien geschaltet. Außerdem wurde der Infohub auf der OeNB-Website stark erweitert. Folder und die Podcast-Folge „Nur Bares ist Wahres?“ bieten einen tieferen Einblick in das Thema „Sicher bezahlen“.
Die Community auf den Social-Media-Kanälen wuchs 2024 kräftig auf 51.000 Follower:innen an: Es konnte über alle Kanäle hinweg ein Zuwachs von insgesamt 38 % erreicht werden (höchster Zuwachs auf LinkedIn und YouTube). Weiters erfolgte erstmals auf den Meta-Kanälen Instagram und Facebook eine Kooperation mit Influencer:innen zum Thema Finanzbildung, wobei rund 190.000 Personen erreicht wurden. 2024 veröffentlichten wir insgesamt acht Podcast-Folgen, die wir abermals alle selbst produzierten. Externe und interne kommunikative Begleitung gab es weiters anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des SSM, also der gemeinsamen europäischen Bankenaufsicht, der neuen OeNB-Finanzbildungs-Website sowie zum mehrjährigen Projekt „digitaler Euro“. Die seit Jahren gut etablierte interne Vortragsreihe „OeNB einfach erklärt“ konnte 2024 mit 18 Vorträgen jeweils rund 200 Teilnehmer:innen online erreichen. Das umfangreiche Publikationssortiment wurde 2024 um die beiden Reihen „OeNB Bulletin“ mit volkswirtschaftlichen Studien sowie „OeNB Financial Literacy Evaluation Series“ zu Themen der Finanzbildung erweitert. Das Nationalbank-Forum „Red ma übern Euro“ — die OeNB-Diskussionsreihe mit der Öffentlichkeit — fand auch 2024 eine Fortsetzung.
OeNB überwacht die Einhaltung des Sanktionengesetzes
Die OeNB hat 2024 ihre gesetzliche Aufsichtsaufgabe im Bereich der Finanzsanktionen ausgeweitet und intensiviert. Insgesamt wurden 45 Aufsichtsmaßnahmen durchgeführt, darunter 21 Vor-Ort-Prüfungen sowie weitere gezielte Kurzprüfungen bei Kreditinstituten (sogenannte Company Visits) und Managementgespräche. Vor-Ort-Prüfungen sind die umfangreichste Form dieser Maßnahmen. Sie finden in der Regel in den Räumlichkeiten des geprüften Instituts statt. Dabei werden sämtliche sanktionsbezogenen Prozesse, Maßnahmen und IT-Systeme evaluiert. Zudem wurden das Management und die Compliance-Verantwortlichen von 19 österreichischen Kreditinstituten in die OeNB eingeladen, um deren sanktionsbezogene Compliance-Systeme darzulegen und Fragen hierzu zu beantworten. Grundlage dieser Aufsichtsmaßnahmen der OeNB ist das Sanktionengesetz 2010. Danach ist die OeNB dafür zuständig, die Einhaltung von Finanzsanktionen durch Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstitute zu überwachen.
In Summe konnten durch diese Aufsichtsmaßnahmen rund 10 % der konzessionierten Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstitute im Sanktionenbereich geprüft werden. Die Erkenntnisse aus den Prüfungen zeigen im Wesentlichen, dass österreichische Kreditinstitute das Thema Sanktionen in ihren Prozessen adressiert haben. Zudem haben die umfassenden Sanktionspakete der EU die beaufsichtigten Institute dazu veranlasst, ihre sanktionsbezogenen Compliance-Maßnahmen nachzuschärfen und zu intensivieren.
Die OeNB ist bestrebt, Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstitute bei der Stärkung ihrer Präventionsmaßnahmen umfassend zu unterstützen. Dadurch sollen eine robuste und effektive Sanktions-Compliance gewährleistet und mögliche Gesetzesverstöße oder -umgehungen vermieden werden. Der Fokus auf mögliche Präventionsmaßnahmen bleibt in diesem Bereich essenziell.
Am 20. November 2024 beschloss der Nationalrat ein Sanktionen-Gesetzespaket (FATF-Prüfungsanpassungsgesetz 2024). Kernstück des Pakets ist ein neues Sanktionengesetz 2024 samt begleitenden gesetzlichen Maßnahmen. Dadurch erfolgt ein Übergang der Behördenzuständigkeit im Bereich der Finanzsanktionen: Ab 2026 wird die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und nicht mehr die OeNB dafür zuständig sein, die Einhaltung völkerrechtlicher Sanktionen durch in Österreich zugelassene Kredit-, Finanz- und Zahlungsinstitute zu überwachen. Damit einher geht auch eine Erweiterung des Kreises der überwachten Unternehmen. So kommen etwa Versicherungsunternehmen, Kryptowerte-Dienstleister und Wertpapierfirmen dazu. Auch die behördlichen Befugnisse werden erweitert. Die OeNB bleibt bis zum 31. Dezember 2025 die zuständige Behörde im Sanktionenbereich, kann jedoch die FMA bereits vor dem 31. Dezember 2025 mit Vor-Ort-Prüfungen im Sanktionenbereich beauftragen.
Ausbau des Risk-Management-Ansatzes der OeNB
In der OeNB ist ein Enterprise Risk Management implementiert, das nach den strategischen Zielen der Organisation weiterentwickelt wird. Dabei sollen die Effizienz sowie der Reifegrad der einzelnen Risikomanagementsysteme der OeNB Schritt für Schritt gesteigert und harmonisiert werden. Konkret handelt es sich um das Compliance-Risikomanagement, das finanzielle Risikomanagement, das Informationssicherheits-Risikomanagement, das operationelle Risikomanagement, das Projektrisikomanagement
sowie das Risikomanagement der OeNB-Beteiligungen.
2024 lag unser Fokus v. a. darauf, ein gemeinsames Risikomanagement-IT-System einzurichten, mit dem die nichtfinanziellen Risiken der OeNB verwaltet und gesteuert werden. Das neue Tool IKARUS konnten wir Anfang Dezember 2024 in Betrieb nehmen und damit den Automatisierungs- und Standardisierungsgrad heben. 2025 werden wir uns darauf konzentrieren, die Funktionalitäten des Tools zu erweitern, die Enterprise-Risk-Management-Methodik weiterzuentwickeln und deren Reifegrad zu steigern.
Neues Risikomanagement-Konzept für das finanzielle Risikomanagement
Das Direktorium beschloss 2024 wesentliche Änderungen im Risikomanagement-Konzept, die ab 2025 wirksam werden.
Das Direktorium wird weiterhin jährlich ein Risk Appetite Statement festlegen. Es drückt aus, inwieweit die OeNB finanzielle Risiken bei der Eigenveranlagung akzeptieren kann. Das Risk Appetite Statement ist zudem ein Ausgangspunkt für die strategische Ausrichtung der Veranlagung und die Grundlage dafür, wie das Risikoregelwerk ausgestaltet ist (z. B. Limite).
Durch das neue Risikomanagement-Konzept ändern sich Herleitung und Begründung des Risk Appetite Statements. Bisher war der mögliche Risikoappetit durch die Risikodeckungsmassen der OeNB begrenzt. Die Risikodeckungsmassen bleiben weiterhin eine wichtige Größe, allerdings wird die Betrachtung um zusätzliche wichtige Einflussgrößen erweitert. Zusammengenommen bilden diese die Risikokapazität der OeNB ab. Bei den zusätzlichen Einflussgrößen handelt es sich um Reputation, Infrastruktur und Know-how der Mitarbeiter:innen.
Innerhalb der Grenzen der Risikokapazität ist für die Festlegung des Risk Appetite Statements die zielorientierte Risikobereitschaft maßgeblich. Darunter verstehen wir die Bereitschaft, Risiken einzugehen, die zur Zielerreichung notwendig sind, während Risiken vermieden werden, die nicht der Zielerreichung dienen. So kann das Risikomanagement die Zielerreichung unterstützen und gleichzeitig vor zu hohen Risiken schützen.
OeNB fördert Wissenschaft und Wirtschaft sowie Kunst und Kultur
Erklärtes Ziel des Jubiläumsfonds der OeNB ist es, für thematisch abgegrenzte Grundlagenforschungs-Vorhaben mit Notenbankbezug faire Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen. Damit wollen wir die Konkurrenzfähigkeit gezielt stärken und die ökonomisch orientierte Forschungslandschaft in Österreich attraktiver machen.
Dazu genehmigte das Direktorium der OeNB 2024 die Finanzierung von 26 Forschungsprojekten mit knapp 6 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft. Primärer institutioneller Fördermittelempfänger war 2024 die Universität Innsbruck mit vier bewilligten Projekten (860.000 EUR).
Unterstützung der Wirtschaftsforschung in Österreich
Unabhängige, hochqualitative empirische Wirtschaftsforschung bringt wichtige Entscheidungsgrundlagen für staatliche Akteur:innen hervor und informiert die Öffentlichkeit durch die Analyse wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die vielfältigen ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart unterstreichen die besondere Bedeutung der Wirtschaftsforschung als relevantes öffentliches Gut. Die OeNB unterstützt dies auch finanziell, um damit einen essenziellen Beitrag für die Unabhängigkeit der institutionellen Arbeit gegenüber Politik und Wirtschaft zu leisten.
Die OeNB hat dementsprechend im Herbst 2021 ihr System an Basisfinanzierungen für österreichische Wirtschaftsforschungsinstitute grundlegend reformiert. Das neue OeNB-Förderprogramm leistete 2024 nachstehende Subventionen an heimische Wirtschaftsforschungsinstitute:
- Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 2.165.000 EUR
- Institut für Höhere Studien (IHS) 1.370.000 EUR
- Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) 715.000 EUR
- Complexity Science Hub Vienna (CSH) 285.000 EUR
Förderung von Kunst und Kultur
2024 erhielt das Engagement der OeNB für Kunst und Kultur durch die organisatorische Zusammenführung der Sammlungen und des Bankhistorischen Archivs in der Gruppe Kunst und Kultur neue Impulse.
Die Kunstsammlung wurde durch Ankäufe von Werken von Ernst Caramelle, Tobias Pils, Flora Hauser und Soli Kiani erweitert. Darüber hinaus konnten wir mit unserer Sammlung mehrere Ausstellungen im In- und Ausland unterstützen, darunter eine Retrospektive von Rudolf Wacker im Leopold Museum und die erste Ausstellung von Martha Jungwirth im Guggenheim Museum Bilbao.
Das Geldmuseum ist mit Leihgaben in Museen im In- und Ausland vertreten, wie etwa im Rahmen der Ausstellungen „Money Talks“ im Ashmolean Museum in Oxford oder „CASH. Der Wert des Bargeldes“ im Technischen Museum Wien.
Öffentlichkeitswirksam sind auch die kostenlosen Führungen und Workshops im Geldmuseum der OeNB. Sie vermitteln einem breiten Publikum Wissen über die Geschichte des Geldes und der Bank. Um dieses Ziel noch besser zu erfüllen, ist eine Modernisierung des Museums geplant.
Im Bankhistorischen Archiv evaluierten wir die Digitalisierung relevanter Bestände, um sie in Zukunft online zugänglich zu machen.
Für das vom Jubiläumsfonds geförderte Projekt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über die Bautätigkeit der Oesterreichisch-ungarischen Bank und der Oesterreichischen Nationalbank 1878—1938 fungierte das Archiv der OeNB als die Hauptquelle zur Forschung an historischen Plänen und Bauakten.
Die Sammlung historischer Streichinstrumente wurde um ein bedeutendes Violoncello aus dem
18. Jahrhundert erweitert. Auch dieses Instrument wird einem Musiker oder einer Musikerin kostenlos zur Verfügung gestellt: Diese Partnerschaft ermöglicht es, dieses einzigartige Kulturerbe auch als Klangkörper für künftige Generationen zu erhalten. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper die Förderung des Musikschaffens an einer seiner wichtigsten Wirkungsstätten.
Unsere Tochterunternehmen ergänzen den OeNB-Geschäftsbetrieb
Die OeNB sorgt gemeinsam mit ihren drei Bargeldtöchtern Münze Österreich AG , Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OEBS) und GELDSERVICE AUSTRIA (GSA) dafür, dass der bare Zahlungsverkehr auch in Zukunft sicher und reibungslos funktioniert. Dabei achten wir gemeinsam besonders darauf, qualitativ hochwertig, sicher, nachhaltig und umweltfreundlich zu wirtschaften.
Die
Münze Österreich AG
ist die offizielle Münzprägestätte der Republik Österreich. Sie hat gemäß Scheidemünzengesetz das alleinige Recht, Scheidemünzen zu prägen und auszugeben. Als eine der weltweit führenden Münzprägestätten stellt sie nicht nur hochwertige Münzen her, sondern stärkt auch das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung des Bargelds. 2024 gab die Münze Österreich AG
1,95 Milliarden Euro-Münzen im Wert von 816 Mio EUR aus. Sie entwickelt weiters laufend neue, innovative Produktlinien wie Sammlermünzen und Edelmetall-Anlageprodukte. So zählt der Wiener Philharmoniker, erstmals 1989 geprägt, zu den international bedeutendsten Anlageprodukten. Er hat die Erfolgsgeschichte der Münze Österreich AG maßgeblich geprägt.
Die OEBS forscht und entwickelt im Bereich der Banknotenherstellung und produziert Banknoten für das Eurosystem. So stellt sie im Auftrag der OeNB den von der EZB jährlich zugeteilten Anteil an Euro-Banknoten her. 2024 waren dies rund 107,51 Millionen 20-Euro-Banknoten. Zudem arbeitet die OEBS eng mit anderen Eurosystem-Notenbanken zusammen und produziert auch für diese Euro-Banknoten. Weiters stellt die OEBS Fremdwährungen für internationale Kunden her. In den letzten Jahren entwickelte sich das Unternehmen von einer reinen Banknotendruckerei zu einem internationalen Kompetenzzentrum, das für Innovation, Nachhaltigkeit und Lösungsorientierung steht.
Die GSA ist Österreichs führender Serviceanbieter für die gesamte Bargeldbearbeitung und für Dienstleistungen im Bereich Bargeldlogistik. Sie bedient damit die OeNB, Banken, Zahlungsdienstleister und den Handel. Mit ihren modernen Cash-Centern stellt sie sicher, dass Bargeld flächendeckend und in hoher Qualität verfügbar ist.
Eine weitere Tochter der OeNB, die OeNPAY Financial Innovation HUB GmbH (OeNPAY) , fördert seit 2021 Innovationen im Finanzsektor. Sie setzt sich auch für die flächendeckende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in Österreich ein. Ziel ist es, den Zahlungsverkehr einfach, stabil und sicher zu gestalten. Als hundertprozentige Tochter der OeNB agiert die OeNPAY neutral am Markt.
Die IG Immobilien-Gruppe verwaltet das Immobilienvermögen der OeNB, strebt nachhaltige Wertsteigerungen des Portfolios an und optimiert die laufenden Erträge.
Die BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH stellt der OeNB und ihren Töchtern die für den Betrieb erforderlichen Immobilien zur Verfügung.
Die Tochtergesellschaften der OeNB veröffentlichen Jahresberichte auf ihren Websites gemäß dem Bundes-Public-Corporate-Governance-Kodex von 2017. Eine Übersicht über die direkten und indirekten Beteiligungen der OeNB findet sich im Beteiligungsspiegel (Tabelle 3).
Beteiligungsspiegel
|
Anteil
in % |
Gesellschaft | Nennkapital | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4175 | Europäische Zentralbank, Frankfurt | 10.825.007.069,61 | EUR | |||
| 100 | Münze Österreich Aktiengesellschaft, Wien | 6.000.000,00 | EUR | |||
| 100 | Schoeller Münzhandel GmbH, Wien | 1.017.420,00 | EUR | |||
| (100) | 100 | Schoeller Münzhandel Deutschland GmbH, Hamburg (Deutschland) | 6.400.000,00 | EUR | ||
| 100 | Rondoro GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 51 | PRINT and MINT SERVICES GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 22,25 | proionic GmbH, Raaba-Grambach | 52.877,00 | EUR | |||
| 22,25 | PI-NB GmbH, Raaba-Grambach | 310.000,00 | EUR | |||
| (1,16) | 5,23 | Naturbeads Ltd, Malmesbury (Vereinigtes Königreich) | 21.461,00 | GBP | ||
| 16,67 | World Money Fair Holding GmbH, Berlin (Deutschland) | 30.000,00 | EUR | |||
| (16,67) | 100 | World Money Fair Berlin GmbH, Berlin (Deutschland) | 25.000,00 | EUR | ||
| (16,67) | 100 | World Money Fair AG, Basel (Schweiz) | 300.000,00 | CHF | ||
| 12,04 | Stirtec GmbH, Kalsdorf | 96.950,00 | EUR | |||
| 100 | Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH, Wien | 10.000.000,00 | EUR | |||
| 29 | PRINT and MINT SERVICES GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 0,25 | Europafi S. A. S., Vic-le-Comte (Frankreich) | 133.000.000,00 | EUR | |||
| 100 | GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H., Wien | 3.336.336,14 | EUR | |||
| 20 | PRINT and MINT SERVICES GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 100 | OeNPAY Financial Innovation HUB GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Immobilien Invest GmbH, Wien | 40.000,00 | EUR | |||
| 100 | Austrian House S.A., Brüssel (Belgien) | 5.841.610,91 | EUR | |||
| 100 | City Center Amstetten GmbH, Wien | 72.000,00 | EUR | |||
| 100 | Cortenbergh 71 S.A., Brüssel (Belgien) | 6.672.000,00 | EUR | |||
| 100 | EKZ Tulln Errichtungs GmbH, Wien | 36.000,00 | EUR | |||
| 100 | HW Hohe Warte Projektentwicklungs- und ErrichtungsgmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Belgium S.A., Brüssel (Belgien) | 19.360.309,87 | EUR | |||
| 100 | IG Hungary Irodaközpont Kft., Budapest (Ungarn) | 11.852,00 | EUR | |||
| 100 | IG Immobilien Beteiligungs GmbH, Wien | 40.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Immobilien Management GmbH, Wien | 40.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Immobilien Mariahilfer Straße 99 GmbH, Wien | 72.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG New Energy GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Immobilien O20-H22 GmbH, Wien | 110.000,00 | EUR | |||
| 100 | IG Netherlands N1 and N2 B.V., Hoofddorp (Niederlande) | 90.000,00 | EUR | |||
| 100 | OWP5 Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH, Wien | 35.000,00 | EUR | |||
| 100 | BLM Betriebs-Liegenschafts-Management GmbH, Wien | 40.000,00 | EUR | |||
| 100 | BLM New York 43 West 61st Street LLC, New York (USA) | 10,00 | USD | |||
| Quelle: OeNB, Beteiligungsgesellschaften. | ||||||
|
Anmerkung: Die OeNB hält an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Basel (Schweiz), 8.000 Stück Aktien zu je 5.000 SZR und 564 Stück Aktien ohne Stimmrecht
sowie an der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), La Hulpe (Belgien), 56 Anteile zu je 125,00 EUR und 8 Anteile zu je 7.760,00 EUR. |
||||||
Tabelle 3 zeigt gemäß § 68 Abs. 4 NBG die direkten und indirekten Beteiligungen der OeNB.
Eigentümer und Organe
Die OeNB ist eine Aktiengesellschaft. Sie unterliegt aber einer Reihe von speziellen Regelungen. Diese ergeben sich aus ihrer besonderen Stellung als Zentralbank und sind im Nationalbankgesetz 1984 (NBG) festgelegt. Das Grundkapital von 12 Mio EUR steht seit Juli 2010 zur Gänze im Eigentum des Bundes.
Generalversammlung
Die Republik Österreich ist Alleinaktionärin der OeNB. Die Aktionärsrechte werden vom Bundesminister für Finanzen in der regelmäßigen Generalversammlung ausgeübt. Zu den Aufgaben der Generalversammlung gehören u. a. die Genehmigung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinns, einschließlich der an die Alleinaktionärin auszuschüttenden Dividende, sowie die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Generalrats und des Direktoriums.
Generalrat
Aufgaben
Der Generalrat ist das Aufsichtsorgan der OeNB. Er berät das Direktorium in Angelegenheiten der Geschäftsführung und der Währungspolitik und überwacht jene Geschäfte, die nicht in den Aufgabenbereich des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) fallen. Der Generalrat tagt in der Regel monatlich. Mindestens einmal im Vierteljahr haben Generalrat und Direktorium eine gemeinsame Sitzung. Die Kompetenzen des Generalrats werden insbesondere in den §§ 20 bis 31 NBG geregelt.
Die Zustimmung des Generalrats ist z. B. erforderlich für: die Neuaufnahme oder Auflassung von Geschäftszweigen, die Errichtung oder Auflassung von Zweiganstalten sowie den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen und Liegenschaften. Das gilt auch für die Besetzung von Aufsichtsräten und geschäftsführenden Organen von Unternehmen, an denen die OeNB beteiligt ist, und die Ernennung von Funktionär:innen der zweiten Führungsebene der OeNB.
Der Beschlussfassung durch den Generalrat sind z. B. vorbehalten: die Erstattung von unverbindlichen Dreiervorschlägen an die Bundesregierung für die Ernennung der Mitglieder des Direktoriums durch den Bundespräsidenten, die Festlegung allgemeiner Grundsätze der Geschäftspolitik in Nicht-ESZB-Angelegenheiten, die Genehmigung des Jahresabschlusses zwecks Vorlage an die Generalversammlung sowie die Genehmigung der Plankostenrechnung und des Investitionsplans für das nächste Geschäftsjahr.
Zusammensetzung
Der Generalrat besteht aus Präsident:in, Vizepräsident:in und acht weiteren Mitgliedern. Alle Mitglieder des Generalrats werden von der Bundesregierung für die Dauer von fünf Jahren ernannt; eine Wiederernennung ist zulässig.
Personelle Veränderung
Am 5. März 2025 liefen die Mandate von Generalrat Mag. Erwin Hameseder und Generalrätin
Dr.in Susanne Riess-Hahn aus. Die Bundesregierung hat über Ernennungen bzw. Wiederernennungen gemäß § 23 Abs. 1 NBG bis Redaktionsschluss noch nicht entschieden.
Gruppenleiter Mag. Alfred Lejsek legte per 31. Mai 2024 auf eigenen Wunsch seine Funktion als Staatskommissär-Stellvertreter zurück. Der Bundesminister für Finanzen bestellte mit Wirkung vom 1. Juni 2024 Gruppenleiterin Dr.in Nadine Wiedermann-Ondrej, MIM zur Staatskommissär-Stellvertreterin.
In der konstituierenden Sitzung des Zentralbetriebsrats vom 3. Oktober 2024 wurde Mag. Dr. Alfred Stiglbauer mit Wirkung vom 3. Oktober 2024 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er löste in dieser Funktion Mag. Christian Schrödinger ab und wurde als stellvertretender Belegschaftsvertreter gemäß
§ 22 Abs. 5 NBG in den Generalrat entsandt.
Mitglieder des Generalrats der OeNB
Stand 31. Dezember 2024
Dr. Harald Mahrer
Präsident
Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich
Ersternennung: 2018
Funktionsperiode:
11.10.2023 – 10.10.2028
Prof.in Mag.a Ingrid Reischl
Vizepräsidentin
Bundesvorstand Österreichischer Gewerkschaftsbund
Funktionsperiode:
11.10.2023 — 10.10.2028
Mag. Silvia Angelo
Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Infrastruktur AG
Funktionsperiode:
11.10.2023 – 10.10.2028
Univ.-Prof. Dr. Leonhard Dobusch
Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, Universität Innsbruck
Funktionsperiode:
11.10.2023 – 10.10.2028
Mag. Erwin Hameseder
Präsident der Raiffeisen-
Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H.
Funktionsperiode:
6.3.2020 — 5.3.2025
Univ.-Prof. Dr.
Christian Helmenstein
Chefökonom der
Industriellenvereinigung
Funktionsperiode:
01.03.2023 – 29.2.2028
Dr. Stephan Koren
Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H.
Ersternennung: 2018
Funktionsperiode:
11.10.2023 – 10.10.2028
Univ.-Prof. Dr.
Stefan Pichler
Vorstand des Institute for Finance, Banking and Insurance, Wirtschaftsuniversität Wien
Funktionsperiode:
11.10.2023 – 10.10.2028
Dr.in Susanne Riess-Hahn
Generaldirektorin der
Bausparkasse Wüstenrot AG
Funktionsperiode:
6.3.2020 — 5.3.2025
Univ.-Prof.in Dr.in
Sigrid Stagl
Ökonomin am Department
für Sozioökonomie,
Wirtschaftsuniversität Wien
Funktionsperiode:
1.3.2023 – 29.2.2028
Staatskommissär
Sektionschef
Mag. Harald Waiglein
Leiter der Sektion für Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte im
Bundesministerium für Finanzen
Ersternennung: 2012
Funktionsperiode:
1.7.2022 – 30.6.2027
Staatskommissär-Stellvertreterin
Dr.in Nadine Wiedermann-Ondrej, MIM
Gruppenleiterin
Gruppe III/C Finanzmärkte
und Finanzmarktlegistik
Funktionsperiode:
1.6.2024 — 31.5.2029
Gemäß § 22 Abs. 5 NBG 1984 werden vom Zentralbetriebsrat zu den Sitzungen des Generalrats entsandt:
Mag.a Birgit Sauerzopf
Vorsitzende des
Zentralbetriebsrats
Dr. Alfred Stiglbauer
Stellvertretender Vorsitzender des
Zentralbetriebsrats
Direktorium
Das Direktorium leitet den Dienstbetrieb und führt die Geschäfte der OeNB. Bei der Verfolgung der Ziele und Aufgaben des ESZB handelt das Direktorium entsprechend den Leitlinien und Weisungen der EZB.
Das Direktorium besteht aus Gouverneur:in, Vize-Gouverneur:in und zwei weiteren Mitgliedern. Sie werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für sechs Jahre ernannt; eine Wiederernennung ist zulässig. Der Gouverneur ist Mitglied des EZB-Rats und des Erweiterten Rats der EZB. Er und seine Vertreterin bzw. sein Vertreter sind bei Wahrnehmung dieser Funktionen weder an Beschlüsse des Direktoriums noch an die des Generalrats gebunden und unterliegen auch sonst keinerlei Weisungen. Für weitere Informationen zum Direktorium der OeNB siehe www.oenb.at .
Von links: Direktor DDr. Eduard Schock, Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann,
Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger, Direktor DI Dr. Thomas Steiner
Personelle Veränderungen
Im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Verträge von Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Holzmann mit 31. August 2025, Vize-Gouverneur Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber mit 10. Juli 2025, Direktor DDr. Eduard Schock mit 10. Juli 2025 sowie Direktor DI Dr. Thomas Steiner mit 30. April 2025 und gestützt auf das Nationalbankgesetz sowie das Stellenbesetzungsgesetz beschloss der Generalrat in seiner Sitzung vom 18. März 2024, die auslaufenden Funktionen auszuschreiben.
Nachdem Univ.-Prof. MMag. Dr. Haber mit Wirkung vom 30. November 2024 vorzeitig seinen Rücktritt erklärte, beschloss der Generalrat in seiner Sitzung vom 24. Juni 2024, den Beginn der Funktionsperiode der Vize-Gouverneurin auf 1. Dezember 2024 vorzuziehen. Der Generalrat hat der Bundesregierung unmittelbar nach dieser Sitzung einen unverbindlichen Dreiervorschlag erstattet. Auf Basis dessen hat die Bundesregierung am 6. August 2024 ihrerseits einen Vorschlag beschlossen und diesen an den Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen übermittelt. Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom
5. September 2024 gemäß § 33 Abs 2 NBG
- Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher zum Gouverneur, mit Wirksamkeit vom 1. September 2025,
- Mag.a Edeltraud Stiftinger zur Vize-Gouverneurin, mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2024,
- DI Dr. Thomas Steiner zum Mitglied des Direktoriums, mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2025, sowie
- Mag. Josef Meichenitsch zum Mitglied des Direktoriums, mit Wirksamkeit vom 11. Juli 2025,
jeweils auf die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Geschäftsordnung
Der Generalrat hat in seiner Sitzung vom 18. Oktober 2024 die neue Geschäftsordnung für das Direktorium, einschließlich der Änderung der Ressortverteilung, mit Gültigkeit ab 1. Dezember 2024, beschlossen. Vize-Gouverneurin Mag.a Edeltraud Stiftinger leitet ab 1. Dezember 2024 das Ressort „Treasury, Rechnungswesen und Statistik“ und Direktor DI Dr. Steiner das Ressort „Finanzmarktstabilität und Bankenaufsicht“. Die Ressorts von Gouverneur Univ.-Prof. Mag. Dr. Holzmann und von Direktor DDr. Schock sind von den Änderungen nicht betroffen.